zur Texte-Übersicht - RR ««« - zurück und weiter
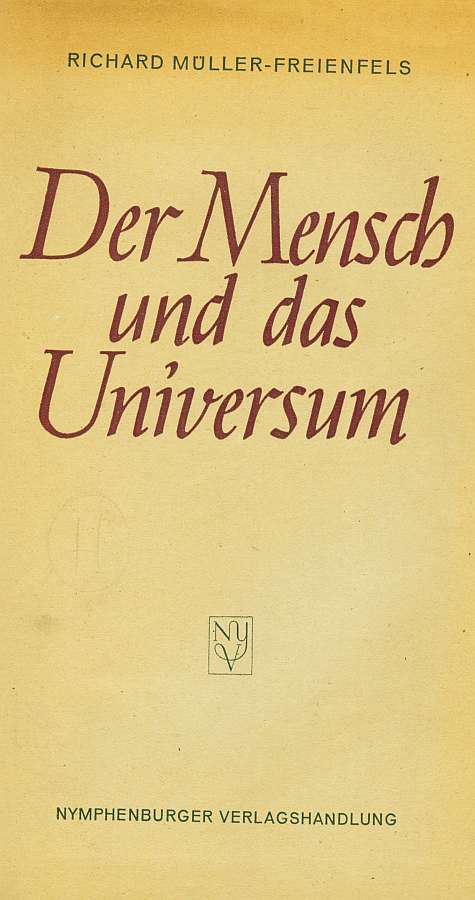
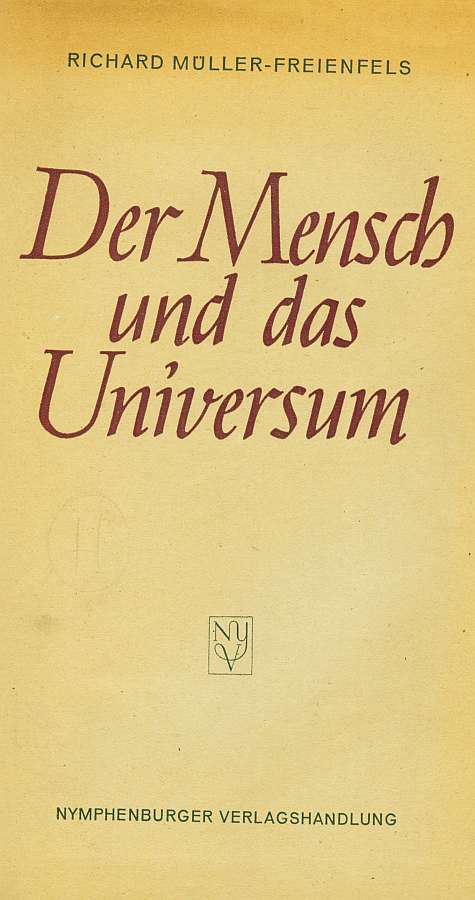
zum Inhaltsverzeichnis
[zum Seitenende].
Der Mensch und das Universum
Philosophische Antworten auf kosmische Fragen
von Richard Müller-Freienfels
Wegweiser-Verlag GmbH., Berlin, 1949
[005]
INHALT
009 Vorwort
I. Mensch und Menschheit in kosmischen Perspektiven
017 Mensch als kosmisches Wesen
019 Rangstellung des Menschen im Kosmos
021 Einheit der Menschheit als biologisches Problem
022 Einheit der Menschheit, soziologisch gesehen
024 Die sogenannten körperlichen Besonderheiten des Menschen
025 Seele und Geist des Menschen
027 Die Struktur des subjektiven Geistes
029 Die Kultur als objektivierter Geist
031 Die Umgestaltung der Erde durch den Geist
033 Die Kultur als kosmisches Geschehen
034 Kultur und Kulturen
036 Das Wesen der Kultur: Gestaltung einer Überwirklichkeit
038 Die Überwirklichkeit in den Religionen
039 Die künstlerische Überwirklichkeit
040 Die Überwirklichkeit in der Wirtschaft
042 Staat und Recht als Überwirklichkeiten
042 Die Überwirklichkeit der Wissenschaft
044 Die Überwirklichkeit der Technik
044 Vielheit und Einheit der Kulturbestrebungen
046 Das Individuum und der Kosmos
047 Die Welt als Boden individuellen „Glücks“
049 Die Welt als Gegenstand individueller Erkenntnis
050 Die Welt als Stätte individueller Vervollkommnung
051 Das Überindividuelle in den Individuen
054 Die Vereinheitlichung der Kulturbestrebungen
055 Kultur und Zivilisation
058 Das Problem des Übermenschen
060 Das Problem der Übermenschheit
062 Der Mensch und das Transzendente
II. Bewußtseinswelt und Weltbewußtsein
067 Die Welt und das Bewußtsein
069 Das Bewußtsein als Zentralproblem der Philosophie
071 Das Wissende und das Gewußte in der Welt
074 Wissen und Werten
076 Das Bewußtsein als wissendes Sein und gewußtes Sein
079 Das menschliche Bewußtsein als kosmischer Tatbestand
080 Das Bewußtsein im Streit der Philosophen
[006]
083 Das Allbewußtsein des Idealismus
085 Das Allbewußtsein und die Individuen
088 Das Bewußtsein der Individuen als Ausgangspunkt
089 Das Bewußtsein in der modernen Psychologie
092 Die Physik und das Bewußtsein
095 Die Zwischenglieder zwischen Subjekt und Objekt
098 Die Übersetzung der Welt ins Bewußtsein
100 Innenwelt und Außenwelt
101 Die Wirklichkeit jenseits des Bewußtseins
103 Biologie und Bewußtseinstheorie. Die Umweltlehre
107 Soziologie des Bewußtseins
110 Das Bewußtsein als Funktion der Kultur
112 Das Schöpferische des Bewußtseins
114 Die genetische Einheit des Bewußtseins
116 Das Problem eines kosmischen Bewußtseins
III. Welt und Wahrheit
123 Die Frage des Pilatus
125 Das Bewußtsein und die Wirklichkeit
127 Objektentsprechung und Allgemeingültigkeit der Wahrheit
129 Das Individuelle im Wahrheitserleben
131 Die Wahrheit als sozial-kultureller Tatbestand
133 Der Gefühls- und Willensfaktor in der Wahrheit
134 Die praktische Seite der Wahrheit
135 Absolute Wahrheit?
137 Kritischer Relativismus
140 Die Vielheit der Erkenntniswege und Wahrheitskriterien
142 Die Sinne als Quelle der Wahrheit
145 Wahrheit aus reiner Vernunft
146 Kants Vereinigung von Sensualismus und Rationalismus
147 Gedächtnis und Phantasie als Mittel der Wahrheitsfindung
149 Die Begriffssprache als Mittel der Wahrheitsfindung
151 Formale Logik und materiale Wahrheit
154 Das problemsetzende Denken als Weg zur Wahrheit
156 Das praktische Handeln und das pragmatische Wahrheitskriterium
157 Exkurs über Mathematik
159 Der Wahrheitswert der Gefühle
160 Die Einfühlungserkenntnis und die Wahrheit
161 Die Wahrheit als Ergänzung verschiedener Erkenntniswege und Kriterien
162 Die Einheit der Wahrheit
164 Die Wahrheit vom Weltganzen
165 Wahrheitserkenntnis und Wahrheitsdarstellung
168 Wahrheit und Schein. Die mystische Wahrheit
169 Erkenntniswahrheit und Bekenntniswahrheit
171 Bekenntniswahrheit im Alltag
172 Bekenntniswahrheit in der Kunst
174 Erkenntnis- und Bekenntniswahrheit in der Religion
177 Das Wahrheitsvertrauen in der Wissenschaft
[007]
IV. Die Einheit der Welt
181 Die Allheit der Welt
183 Die einheitliche Ganzheit der Welt
185 Einheit des Gleichen: Die begriffliche Vereinheitlichung
189 Vereinheitlichung des Ungleichen: Ergänzungseinheiten
190 Ist die Erde ein typischer Weltkörper?
192 Die Erde in kosmischen Ergänzungsbeziehungen
193 Die Einheit des Erdgeschehens
195 Die Einheit der Welt und die Wissenschaften
197 Die Einheit der Welt und die Philosophie
198 Die philosophischen Einheitsprinzipien in den Spezialwissenschaften
200 Die idealistische Vereinheitlichung der Welt
203 Die räumliche Einheit der Welt
205 Die zeitliche Einheit der Welt
208 Die Substanz als Einheitsprinzip der Welt
211 Die Form als Einheitsprinzip der Welt
213 Die Welt als kausalgesegliche Einheit
216 Der Endzweck als Einheitsprinzip der Welt
218 Die Entwicklung als Einheitsprinzip der Welt
222 Revolutionärer Charakter des Entwicklungsgedanken
225 Entwicklung und Ergänzung
231 Der „Sinn“ als Einheitsprinzip der Welt
234 Die Symphonie der Welt und der Einzelmensch
237 Die Wissenschaft und das Transzendente
[009]
Vorwort
Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen,
die sich über die Dinge ziehn.
Ich werde den Letzten vielleicht nicht vollbringen,
aber versuchen will ich ihn ...
Rainer Maria Rilke
...
Viele heutige Philosophen treten an die Probleme nur mit einer, wie sie meinen, rein philosophischen und unfehlbaren Methode heran, einerlei, ob es die transzendentale, die spekulative, die [010] phänomenologische, die existentialphilosophische oder eine andere ist, und sie versuchen, durch formale Umbildung und Neufrisierung alter Begriffe neue Erkenntnisse zu gewinnen, die, bei Licht besehen, oft in neue Vokabeln gepreßte alte Binsenwahrheiten sind. Gewiß ist es notwendig, daß die Philosophie ihre Methoden umbildet und erweitert; aber es ist vor allem notwendig, daß sie ihr Denken mit den umwälzenden Erkenntnissen der Einzelwissenschaften in Kontakt erhält. Das wird hier, soweit es der Raum gestattet, versucht.
Ich habe dabei für mein Buch, das sich nicht an Fachgelehrte allein wendet, nicht eine streng systematische Darstellung gewählt, sondern behandle in vier gesondert lesbaren Essays (zu deutsch „Versuchen“) einige fundamentale Probleme der Philosophie, die doch alle in dem Hauptproblem, dem Verhältnis des Menschen zum Universum, zusammenlaufen. Daß sich dabei die Gedankengänge zuweilen überkreuzen, ist nicht zu vermeiden; aber vielleicht hat es auch seine Vorzüge, daß die gleiche Problematik in verschiedenen Zusammenhängen beleuchtet wird. Es soll sich jedoch keineswegs um Popularisierung der Forschung in dem Sinne handeln, daß die Probleme verflacht und ihre Schwierigkeiten vertuscht werden. Ich betone das gegenüber jenen gerade in Deutschland so häufigen Lesern, die nur in Schwerverständlichkeit ein Anzeichen von „Tiefe“ sehen. Eine Erkenntnis, die nicht auf die klarste und einfachste Form gebracht ist, bleibt stets eine unfertige Erkenntnis.
Schwerverständlichkeit bringt den billigen Vorzug mit sich, daß der Verfasser sich unangreifbar macht und sich damit wehren kann, der Leser habe ihn nicht verstanden. Trägt man jedoch die Gedanken in klarer und einfacher Form vor, so stellt sich ihre Richtigkeit offen der Beurteilung dar. Ich hoffe, diese nicht zu scheuen zu brauchen.
Der erste Versuch: Mensch und Menschheit in kosmischen Perspektiven stellt die Frage nach Stellung und Sinn der „Menschheit“ und des „Einzelmenschen“ in einer Welt, die sich durch die neuere Forschung auf allen Wissensgebieten nicht nur in Hinsicht des Raums und der Zeit ins Ungeheuerliche erweitert hat. Was man gewöhnlich „Weltanschauung“ nennt, ist im besten Falle „Erdanschauung“, sieht den Menschen von heute noch immer als Mittelpunkt und Höhepunkt des Kosmos an und nennt „Weltgeschichte“ die paar Jahrtausende des Kulturgeschehens, die im Universum, mindestens räumlich und zeitlich, wenig mehr als ein Nichts sind. Es gibt noch heute „Philosophen“, für die Kopernikus oder gar Einstein überhaupt nicht gelebt zu haben scheinen. Gegenüber der Frage, was die Welt für den Menschen bedeute, wird hier die Frage gestellt, was der Mensch im Kosmos und für den Kosmos bedeutet.
Freilich ergibt sich dabei, daß sowohl die „Menschheit“, wie „der Einzelmensch“ nur Abstraktionen sind, die in Wirklichkeit gar nicht vorkommen. Allein wirklich sind nur Menschen, die innerhalb ihres Kulturkreises, neben dem es jedoch noch viele andere und recht verschiedene „Kulturen“ gibt, sich entwickeln und wirken, also daß „der Mensch“ nur zu verstehen ist in seiner Verflochtenheit in das [011] Kulturgeschehen. „Kultur“ aber wird nicht als Willkürgebilde des Menschen gefaßt, sondern als ein, wenn auch nur auf der Erde nachweisbares, doch kosmisch bedingtes und bedeutsames Geschehen, nicht minder notwendig und tief wirkend, als es die Verfestigung der Erde zur Materie oder die Entstehung und Ausbreitung des vegetativen und animalischen Lebens auf der Erdoberfläche waren. Als Formel für das Gemeinsame aller Kulturkreise und Kulturzweige wird die Schaffung einer „Überwirklichkeit“ aufgestellt, die nicht Unwirklichkeit ist, sondern die die gesamte Erde, den Menschen selbst inbegriffen, geistig und materiell umgestaltet und auch in den Kosmos hinausstrebt. Es wird zu zeigen sein, daß nicht bloß die Religion, sondern auch Kunst, Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Technik alle auf ihre besondere Art auf Schaffung einer „Überwirklichkeit“ gerichtet sind, der gegenüber das Dasein des einzelnen Menschen besondere Probleme bietet. Dabei wird nie zu vergessen sein, daß die paar Jahrtausende menschlicher Kultur, die wir überschauen, an sonstigen kosmischen Zeitmaßen gemessen, höchstens die ersten Szenen eines neuen Aktes in einem gewaltigen Drama sind, von dem wir nicht wissen, wieviel Akte noch folgen werden. Immerhin läßt sich versuchen, aus der Handlung dieser ersten Szenen mit Vorsicht Schlüsse zu ziehen auf den Weitergang, und aus Vergangenheit und Gegenwart einige Perspektiven auf die Zukunft zu gewinnen, die ja ebenfalls im Begriffe „Welt“ mitgedacht werden muß.
Der zweite Essay: Bewußtseinswelt und Weltbewußtsein stellt die Frage nach Wesen und Bedeutung des „Bewußtseins“, dieses merkwürdigen Tatbestandes, den viele Denker radikal von der übrigen „Welt“ trennen. Meine Darstellung geht von der Tatsache aus, daß der Welt nicht bloß Dasein, sondern auch Bewußtsein zukommt, und zwar in dem doppelten Sinne, daß die Welt – wenigstens im Menschen – „wissend“ ist, daß sie aber zugleich – mindestens in “beträchtlichen Teilen – auch „bewußt“ im Sinne von „gewußt“ wird und also „wißbar“ sein muß. Insofern ist die Welt, in der wir leben, eine „Bewußtseinswelt“. Dabei aber entsteht die Frage, ob es Bewußtsein nur in den Köpfen menschlicher Individuen gibt, oder ob es ein überindividuelles Bewußtsein oder gar ein kosmisches, also ein Weltbewußtsein gibt, die Frage mithin, ob der Welt als Ganzes Bewußtsein nicht nur im Sinne der Wißbarkeit, sondern auch des Wissendseins zukommt.
Dies bedingt eine Auseinandersetzung mit der idealistischen Philosophie, die – wenn auch in sehr verschiedenen Formen – bestrebt war, das Wesen der Welt nur im Bewußtsein zu suchen und alles „Dasein“ nur als Inhalt des Bewußtseins, nicht zwar des Bewußtseins einzelner Menschen, so doch eines kosmischen, eines Allbewußtseins zu fassen, das zumeist mit der Gottheit gleichgesetzt wird. Die Wirklichkeit einer außerhalb des Bewußtseins bestehenden Welt wird dabei, mehr oder weniger kühn, geleugnet. Zwar versuche ich, diese Weltanschauung psychologisch zu verstehen und, was haltbar ist, zu übernehmen; aber in Übereinstimmung nicht nur mit dem „gesunden [012] Menschenverstand“, sondern auch mit allen Einzelwissenschaften wird die Wirklichkeit einer an sich nicht völlig bewußten, aber dem Bewußtsein weithin zugänglichen, ja auf Bewußtwerdung angelegten Welt zu erweisen gesucht.
Der Begriff „Bewußtsein“ wird dabei nicht bloß als metaphysischer Tatbestand genommen, obwohl er das auch ist, sondern es wird herangezogen, was neuerdings Psychologie und Physik, Biologie und Soziologie in empirischer Forschung über das Bewußtsein oder seine Beziehungen zur Welt an gesicherten Erkenntnissen erbracht haben. Dabei tritt heraus, daß das Bewußtsein keineswegs ein getreuer Spiegel ist, der die Welt, so wie sie „in Wirklichkeit“ ist, auffängt, sondern daß unser Bewußtsein nur zum Teil auf „wahres“ Wissen, vielmehr mindestens ebensosehr, und zwar als Faktor der gesamten Kultur, auf geistige und materielle Umgestaltung der Wirklichkeit gerichtet ist. Dadurch entstehen Probleme, die eine reine „Erkenntnis“-Theorie gar nicht sieht. Denn die Welt ist nicht bloß Gegenstand des Wissens und Erkennens, sondern auch des Wertens und Wirkens, und es ist falsch oder mindestens einseitig, wenn man das Wesen des Bewußtseins nur im „Wissen“ sieht. Das gilt sowohl für das „Bewußtsein“ ganzer Kulturgruppen wie das der isoliert gesehenen Individuen, deren Verhältnis zur Welt besondere Probleme stellt. Erst nachdem in Kürze dargelegt ist, was empirische Forschung über das menschliche Bewußtsein zu sagen hat, wird die Frage nach dem metaphysischen Wesen des Bewußtseins, die Frage nach seiner Herkunft und seiner Entwicklung innerhalb der Gesamtwelt, aber auch die Frage nach einem kosmischen Bewußtsein mit aller nötigen Vorsicht gestellt.
Der dritte Essay: Welt und Wahrheit knüpft an den vorherigen an, insofern er zeigt, daß das Bewußtsein zwar keineswegs bloß auf Wahrheit gerichtet ist, aber daß das Streben nach Wahrheit dennoch ein unerläßlicher Kulturfaktor ist. Es fragt sich also: Wodurch unterscheidet sich das mit dem Anspruch auf Wahrheit auftretende Bewußtsein von Irrtum, Traum, Selbsttäuschung, Schein und Lüge? Die landläufige Meinung freilich, daß Wahrheit die „Übereinstimmung“ des Bewußtseins mit einer außerhalb des Bewußtseins bestehenden, von ihm trennbaren „Wirklichkeit“ sei, erweist sich als irrig. Von vollkommener Übereinstimmung oder gar Gleichheit zwischen der zumeist materiellen Wirklichkeit und den flüchtigen immateriellen Bewußtseinszuständen kann nicht die Rede sein. Vielmehr handelt es sich bei allem Bewußtsein, auch bei der Wahrheit, höchstens um eine „Übersetzung“ in ein ganz anderes „Material“, wobei zwischen dem Bewußtsein und seinen Gegenständen nur das Verhältnis einer „Entsprechung“ besteht, die freilich nicht bloß individuelle, sondern überindividuelle Geltung beansprucht und immerhin ausreicht, ein praktisches Wirken des Menschen in der Welt zu gewährleisten.
Im einzelnen werden dann die verschiedenen Möglichkeiten geprüft, die der Mensch nutzt, um zur Wahrheit über die Welt zu gelangen: Sinne, Vernunft, Gedächtnis und Phantasie, die Gefühle, [013] das praktische Behandeln der Objekte und anderes. Darüber hinaus sind die besonderen Kriterien, auf Grund deren man Wahrheit und Irrtum zu scheiden sucht, zu erörtern. Ergibt sich dabei auch, daß keine der genannten Möglichkeiten und kein Kriterium die absolute Wahrheit garantiert, so wird doch nicht bestritten, daß in sich ergänzender Zusammenarbeit der verschiedenen Möglichkeiten vieles gefunden ist, was als „Wahrheit“ für die Menschen gelten kann.
Ob freilich alle ermittelten Einzelwahrheiten die ganze Wahrheit über die erforschten Gegenstände ergeben, vor allem aber, ob eine einheitliche Wahrheit vom Weltganzen für Menschen möglich ist, sind Probleme, in deren Beantwortung man zurückhaltend sein muß. Auch ersteht dabei die Frage, ob die Erkenntniswahrheit der Wissenschaft die einzige Art der Wahrheit ist, zumal man auch in Kunst und Religion von „Wahrheit“ spricht, wobei hier etwas ganz anderes gemeint ist als die Wahrheit der Wissenschaft; damit wird dann das Verhältnis von Wissen und Glauben zum Problem.
Im letzten Essay wird das Problem der Einheit der Welt aufgegriffen, ein Problem, das weit vielspältiger ist, als gemeinhin angenommen wird. Zur Vorsicht muß vor allem die Tatsache stimmen, daß wir einigermaßen sichere Kenntnisse nur über die Verhältnisse auf der Erde haben, daß aber höchst zweifelhaft ist, ob die Erde als typisch für all die Multimillionen Gestirne des Weltalls gelten kann. Ja, selbst die Einheit des irdischen Geschehens erweist sich, gerade durch die Wissenschaften, als weit problematischer, als man gemeinhin – auch in der Philosophie – angenommen hat.
Trotzdem werden die Prinzipien, nach denen die Philosophie bisher die Welt als Einheit aufzufassen suchte, in ihrer Bedeutung gewürdigt. Die Begriffe Raum und Zeit, Substanz und Formung, Kausalität und Finalität werden, auch in ihrer Ausgestaltung durch die modernen Spezialwissenschaften, daraufhin zu prüfen sein, ob sie wirklich als Einheitsprinzipien des Kosmos gelten können. Reicht auch keines dieser Prinzipien allein aus, so weisen sie doch in ihrer Ergänzung auf eine Einheitlichkeit der Welt hin. Speziell zu der heute verbreiteten Lehre, daß es eine einheitliche Entwicklung in der Welt gäbe, ist Stellung zu nehmen. Dabei ergibt sich, daß die sogenannte „Entwicklung“ weder in sich einheitlich ist, noch die Ganzheit der Welt umfaßt. Es wird vielmehr die Nichtentwicklung oder die sehr geringe Entwicklung großer Partien der Welt erwiesen. Dafür aber wird hervorgehoben, daß gerade die Nichtentwicklung dieser Partien die Entwicklung anderer Partien der Welt ermöglicht und mit diesen in unentbehrlichem Ergänzungsverhältnis steht, das auf einen „Sinn“ des Weltgeschehens hinweist, der Entwicklung und Nichtentwicklung einheitlich übergreift. Dieser Zentralbegriff meiner Philosophie, der Sinn in einer später genauer zu präzisierenden Bedeutung, eröffnet den Ausblick auf eine Einheit der Welt, eine Einheit nicht des Gleichen, die man bisher fast ausschließlich gesucht hat, sondern eine Einheit gerade des Ungleichen, eine wechselseitige Ergänzung des [014] Vielheitlichen und Verschiedenen in der Welt. Es wird dabei allerdings betont, daß die Welt, wie wir sie heute kennen, ja nicht irgendwie „fertig“, sondern daß mindestens unsere Erde stärker und rascher als früher in einem Wandlungsprozeß begriffen ist. Daher darf jede Sinndeutung gegenüber der Welt, auch jede Aussage über die Einheit dieses Sinnes, nicht etwas Abgeschlossenes bieten, sondern höchstens vorsichtige Perspektiven auf künftiges Geschehen. Ohne die kulturelle Bedeutung der religiösen, dichterischen und philosophischen Spekulation zu leugnen, bemühe ich mich doch, in meinen Darlegungen streng auf dem Boden kritischer Erfahrung zu bleiben.
Obwohl das Buch stets den Kontakt mit der bisherigen Philosophie und den Ergebnissen der Einzelwissenschaften zu wahren sucht, wird ein aufmerksamer Leser nicht verkennen, daß es sich überall selbständig zu seinen Problemen stellt und mancherlei neue Probleme anschlägt und behandelt, die bisher kaum beachtet sind. In systematischer Form habe ich meine Gedanken in zwei großen Werken: „Der Sinn in der Welt“ und „Die Erforschung des Unerforschlichen“ entwickelt, die infolge der Kriegsläufe bisher nicht im Druck erscheinen konnten.
Berlin-Dahlem 1947
Richard Müller-Freienfels
[015]
I
MENSCH UND MENSCHHEIT IN KOSMISCHEN PERSPEKTIVEN
Blickst nachts du in den Weltenraum,
Siehst drin du tausend Sterne sprießen;
so voll erblüht kein Erdenbaum,
so glänzt es nicht aus Erdenwiesen.
Die Sterne scheinen kalt und bleich,
Und doch, durchs Rohr beäugt genau,
sind sie an Glanz und Glut nicht gleich,
sind sie teils rot, teils weiß, teils blau.
Teils sind die Knospen, kaum entfaltet,
teils Blumen, sommerlich erblüht,
teils Früchte, prall vom Herbst gestaltet,
teils längst erstarrt und längst verglüht.
Und unser kleines Erdgestirn?
Und drauf des Menschen winzig Hirn?
Sind die nun in der Zeiten Flucht
noch Knospe? Oder reife Frucht?
[065]
II
BEWUSSTSEINSWELT UND WELTBEWUSSTSEIN
Nicht reines Glas ist unser Geist,
das uns die Welt korrekt erschließt;
der Mensch nutzt ihn als Spiegel meist,
drin er sein eigen Ich genießt.
Das Glas ist oftmals wenig klar,
und es verwandelt die Natur:
dem dünkt sie licht und wunderbar,
dem zeigt sie dunkle Schatten nur.
Dem macht sehr groß, was sonsten klein,
sein Glas, in Linsenform gepreßt;
der spaltet drin den Sonnenschein,
den er durch Prismen wandern läßt.
Vor gleiche Dinge hingestellt,
sieht jeder sie auf seine Art.
Ist nun für alle gleich die Welt?
Hat jeder seine Welt apart?
Den Pinsel für sein Weltenbild
tunkt jeder in den eignen Topf,
Stammt drum das Bild, das ihm entquillt,
ganz aus des Malers eignem Kopf?
[067]
Die Welt und das Bewußtsein
Den Inbegriff alles Seienden fassen wohl alle Sprachen in einem Worte zusammen, das man unbedenklich und oft sogar gedankenlos im Munde führt, als wäre das damit Bezeichnete ein bekannter oder gar erkannter Tatbestand. Im Deutschen besitzen wir das Wort „Welt“, das, ebenso wie das englische „world“, aus einem altgermanischen Worte „weralt“ entstanden ist, das sich seinerseits zusammensetzt aus den beiden Stämmen „wer“ = „Mann“, „Mensch“, und „alt“ einer Zeitbezeichnung, die im Neuhochdeutschen im Begriff Zeitalter noch weiterklingt. Diesen Sinn hatte das Wort „old“ im Altnordischen, während im Gotischen „alds“ allein schon „Welt“ bedeutete. „Weralt“ heißt also ursprünglich „Menschenzeit“ oder auch „Menschenwelt“, wobei mitschwingt, was durchaus berechtigt ist, daß die Welt nicht nur ein räumlicher, sondern auch ein zeitlicher Tatbestand ist; und es wird sich im Laufe unserer Darstellung auch rechtfertigen, daß das, was wir „Welt“ nennen, nicht die Welt „an sich“, das „Absolute“ der Philosophen ist, sondern die Welt, wie sie sich dem Menschen darstellt: weralt, die Menschen-Welt ! – Das entsprechende griechische Wort ist „Kosmos“, das ursprünglich „Schmuck“, „Ordnung“ heißt und damit die ästhetische Seite des Tatbestands betont. Das ist ähnlich mit dem lateinischen Worte „mundus“, woneben allerdings noch der Begriff „Universum“ besteht, der die Einheitlichkeit der Welt hervorhebt. Ob diese spezielleren Charakterisierungen zu Recht bestehen, lassen wir vorläufig dahingestellt. Ganz sicher aber ist, daß man damals, als jene Begriffe entstanden, nicht ahnen konnte, wie sich deren Umfang später ausweiten würde, also daß wir heute, wenn wir wirklich jenen Worten ihren vollen Sinn geben, nicht etwas Bekanntes damit bezeichnen, sondern etwas Unbekanntes, Ungeheuerliches, Unbegrenztes, ein Etwas mithin, das wir – mindestens in der sprachlichen Form – mit negativen Ausdrücken charakterisieren müssen. Denn eine wirkliche „Definition“, zu deutsch: „Abgrenzung“, ist der „Welt“ gegenüber in keiner Form möglich.
Die Menschen früherer Jahrtausende dachten, soweit sie nicht einfach „Welt“ und „Erde“ gleichsehen, nur den sichtbaren Himmel mit, der, wie sie glaubten, die Welt als kristallenes Gewölbe abschlösse. Dies Gewölbe ist jedoch durch die neuere Forschung gesprengt; der [068] „Himmel“ ist uns kein Abschluß mehr, sondern ein Fenster in unvorstellbare Weiten. Und die sichtbaren Sterne, die man früher für „unzählig“ hielt, gelten uns nicht mehr als freundliche Himmelslichter, sondern wir wissen, daß sie zumeist Ballungen glühender Gase sind, millionenfach größer als unsere Erde. Sie sind auch nicht mehr „ungezählt“, sondern man weiß, daß wir mit bloßem Auge höchstens fünftausend Sterne sehen; blicken wir jedoch durch ein modernes Riesenfernrohr, so ergibt sich, daß auf jeden dieser dem unbewaffneten Auge sichtbaren Sterne in Wahrheit vierzig Millionen kommen, also daß – zur Zeit – etwa 200 000 000 000 (in Worten: zweihunderttausend Millionen) Sterne sichtbar, gemacht werden können, die zusammen das Sternsystem bilden, das wir unsere Milchstraße nennen. Aber selbst diese Sterne zusammen bilden nicht die ganze Welt, sondern unsere Milchstraße ist nur eine neben Millionen von anderen „Milchstraßen“, die als „Spiralnebel“ vor unseren Fernrohren flimmern und alle wohl ebenfalls aus mehreren Milliarden Sternen bestehen. Indes, so groß die Sterne sind, noch viel größer ist der Raum, der zwischen ihnen liegt und der sich nach neuesten Forschungen sogar beständig erweitert. – Dabei ist mit alledem nur eine Unendlichkeit erschlossen; denn neben dem Unendlich-Großen besteht das Unendlich-Kleine. Jedes Sandkorn, das wir in die Hand nehmen, umschließt Atome in einer Ziffer, die noch weit größer ist als die, mit denen wir die Zahl der Sterne berechnen; aber auch mit den Atomen haben wir keine Grenze erreicht; denn ungeachtet ihres Namens, der sie als „die Unteilbaren“ bezeichnet, kennen wir heute ihre Teile und deren Ordnung, die an die von Planeten umkreiste Sonne erinnern kann; aber schon ist es fraglich geworden, ob diese Teile, die Elektronen, Positronen, Neutronen, einheitliche Gebilde sind. – Unendlichkeit auch hier! „Kühne Seglerin, Phantasie, wirf ein mutloses Anker hie!“ so dichtete Schiller angesichts des damals bekannten Weltalls, ohne freilich zu ahnen, daß ein Jahrhundert später das wissenschaftliche Denken die Anker in noch weit größere Fernen lichten sollte.
Und doch tun sich noch weitere Unendlichkeiten auf, wenn wir die Welt nicht bloß als räumliche Architektur, sondern als eine in der Zeit sich entfaltende Symphonie begreifen, als welche sie sich uns ebenfalls darstellt. Denn die Welt „ist“ nicht bloß, sie „geschieht“, und die Zeiträume, mit denen wir rechnen müssen, wenn wir das Alter der Gestirne abschätzen wollen, erfordern nicht minder vielstellige Zahlen als die Berechnung des Raumes, wobei es völlig im Dunkeln bleibt, ob von einem Anfang oder einem Ende der Welt gesprochen werden darf, obwohl die Physiker das Gespenst des Kältetodes des Universums an die Wand malen.
Davor freilich brauchen wir uns nicht zu fürchten, bis dahin hat es gute Weile, und die Welt wird inzwischen noch viele Wandlungen durchlaufen; denn unübersehbar ist nicht nur die abstrakte Zeit, sondern auch die Fülle der Gestaltungen und Wandlungen, die sie [069] „zeitigt“. Nicht nur quantitativ, auch qualitativ ist das Weltgeschehen unendlich. Die Sterne, die sich für unser Auge nur durch Größe und Helligkeit zu unterscheiden scheinen, sind in Wahrheit qualitativ mindestens so verschieden voneinander wie etwa die Pflanzen auf der Erde. Und verschieden sind sie nicht nur als Ganzes, sondern bis in alle ihre Einzelteile hinein, also daß es höchst unwahrscheinlich ist, daß auf irgendeinem Planeten jener zahllosen Sonnen, die wir sehen, und den ebenfalls ungezählten „erloschenen“ Sonnen, die wir nicht sehen, Menschen wie wir existieren, wenn auch vielleicht Lebewesen anderer Art.
Und doch sagten wir, daß der Ausdruck „Menschenwelt“ für das Universum, das wir sehen und denken, zu Recht bestünde; denn der Kosmos, den wir sehen und denken, ist der Kosmos, wie er sich unserem menschlichen Bewußtsein darstellt; und wir denken, ja, wir müssen, wenn wir „Welt“ denken, auch den sehenden und denkenden Menschen mitdenken, „in“ dessen Bewußtsein erst die Welt zur Welt im menschlichen Sinne wird. Denn auf jeden Fall ist, wie der Mensch selbst, so wenig er im Universum bedeuten mag, auch sein Bewußtsein ein kosmischer Tatbestand. Und zum Wesen der Welt gehört, daß sie – wenigstens zum Teil – wißbar und – wenigstens im Menschen – auch wissend ist Damit aber stehen wir vor unserem Problem, der Rolle des Bewußtseins, nicht nur für den Menschen, sondern in der Welt und für die Welt. Und dies Problem ist, da sich der Mensch vor allem als „bewußtes“ Wesen fühlt, auch für seine Stellung im Universum von zentraler Bedeutung.
Das Bewußtsein als Zentralproblem der Philosophie
So ungeheuerlich die Größendiskrepanz ist zwischen dem unendlichen Weltall und dem kleinen Menschenhirn, das jenes wahrnimmt, und denkt, so ist doch nicht zu bestreiten, daß das Licht all der Multimillionen Sterne erst im Bewußtsein aufleuchtet. Ohne Bewußtsein wäre die Welt ein ungeheures Etwas ohne Licht, ohne Farben, ohne Wärme, ein Etwas, in dem es weder Klang noch Duft, weder Schönheit noch Wahrheit gäbe. Die Welt existiert für uns erst durch unser subjektives Bewußtseinserleben; aber sie wird dadurch selbst zugleich reicher, sie wird dadurch erst zur „Welt“ im vollen Sinne, den alle Menschen diesem Worte beilegen, und es ist insofern nicht unberechtigt, daß wir, obwohl es nur subjektiv-menschliche Erlebnisse sind, Licht, Wärme und alle anderen Qualitäten der Welt selbst zuschreiben, schon darum, weil der Mensch ja zur „Welt“ gehört und sein Bewußtsein nicht auf einem außerweltlichen Standpunkt der Welt gegenüber steht, sondern selbst ein Teil der Welt ist und durch Vermittlung des Auges und anderer Sinne weit in die übrige Welt hinausdringt. Zwar sucht die Naturwissenschaft in ihrem Bestreben, die „objektive“ Wahrheit zu ermitteln, die subjektiven Sinneserlebnisse möglichst [070] auszuschalten. Sie übersetzt alles Qualitative, alle sinnlichen Eigenschaften, in Quantitatives, in Maßzahlen. Wenn sie von „Licht“ redet, so meint sie Wellen von berechenbarer Länge und Frequenz; wenn sie „Schall“ sagt, so meint sie Luftwellen, die ebenfalls rein zahlenmäßig unterschieden werden. Daß die Wissenschaft trotzdem Worte wie „Licht“, „Wärme“, „Schall“ gebraucht, auch wo sie nur die im subjektiven Erleben licht wirkenden, wärme wirkenden, schall erzeugenden objektiven Tatbestände meint, ist ein logisch nicht zu rechtfertigender Usus. Und ganz kann sie trotz allen Bemühens das Subjektive nicht ausschalten. Sie setzt ein abstraktes, gespenstisches Gerüst von Zahlen, Gleichungen, Gesetzen an Stelle der konkreten, bunten Welt, die wir erleben; aber auch jene Zahlen und Gesetze sind nicht die Welt an sich, auch sie sind im Bewußtsein „gedacht“, sie sind Abstraktionen und als solche Bewußtseinsinhalte!
Ganz im Gegensatz zur Naturwissenschaft und allen Einzelwissenschaften, die nur „objektive Tatsachen“ ermitteln wollen, hat die Philosophie von früh an betont, daß eine reine Objektivität nicht zu erkennen ist, sondern daß jede Objekterkenntnis zugleich ein subjektives Erleben ist, und daß alles Bewußtsein von der Welt zugleich doch Bewußtsein von der Welt ist. Es ist praktisch nützlich und berechtigt, wenn die Einzelwissenschaften das Subjektive „einklammern“; aber es ist ebenfalls berechtigt und ein höherer Gesichtspunkt, wenn die Philosophie auch das Bewußtsein von der Welt und das Bewußtsein in der Welt zum Problem macht. Daß dabei viele Philosophen soweit gehen, ihrerseits die Objektivität der Welt, ja die Welt selbst nicht nur „einzuklammern“, sondern sie sogar nur als „Inhalt“, als „Setzung“ des Bewußtseins anzusehen, ist eine Haltung, die wir später zu prüfen haben. Vorläufig nehmen wir die objektiven Tatsachen, die „Welt“ also, die der gesunde Menschenverstand und auch die Einzelwissenschaften – allerdings auf Grund des Bewußtseins – feststellen, durchaus als jenseits des Bewußtseins bestehend an, zugleich aber betonend, daß jede Tatsache zugleich eine Bewußtseinssache ist, nicht nur, wie manche meinen, dadurch verändert und entstellt, sondern auch bereichert.
Trotzdem und gerade dabei aber bleibt jene Größendiskrepanz bemerkenswert, von der wir ausgingen, daß wir Bewußtsein nur auf der Erde, und zwar in Menschenhirnen kennen, vielleicht noch bei Tieren, aber da in so unentwickelter Form, daß es den Begriff „Welt“ ganz sicher nicht zu denken vermag. Angesichts der Kleinheit des Menschen schon gegenüber dem Erdganzen, aber noch mehr gegenüber den ungeheuren Sternen und Spiralnebeln, auf denen wir denkende Wesen, die wie der Mensch Bewußtsein hätten, nirgends nachweisen können, scheint das Bewußtsein zu unbedeutender Unwesentlichkeit zusammenzuschrumpfen. Und das tritt noch krasser hervor, wenn wir neben dem räumlichen den zeitlichen Gesichtspunkt hinzunehmen; denn dann ergibt sich, daß der Mensch und sein Bewußtsein auf der Erde erst im bisher allerletzten Kapitel der [071] bisherigen Erdgeschichte erscheint, und daß die Zeit, in der er ernsthaft versucht, sich ein Bild des Weltganzen zu schaffen, zur Gesamtgeschichte auch nur der Erde sich so verhält wie – um einen Vergleich eines großen Astronomen heranzuziehen – der letzte Buchstabe der Bibel zur Gesamtheit der Heiligen Schrift.
Der dichterisch schöne Schöpfungsmythus der Bibel ist also darin nicht ganz korrekt, daß das „Licht“ am ersten Tage geschaffen worden sei; Licht und jede Art von Bewußtsein gibt es erst in der Welt, seit es lichtempfängliche bewußte Wesen in der Welt gibt. Obwohl die Erde schon in ihrer Frühzeit ein selbst Strahlen von der Art, die wir als Licht- und Wärmestrahlen empfinden, aussendender und empfangender Stern war, gab es auf ihr kein Licht und keine Wärme als Bewußtseinserlebnisse, und die gewaltigen Eruptionen, die die Urgebirge auftürmten, verursachten wohl Schallwellen, aber keinen Schall. Jene Welt ohne Bewußtsein war farblos, temperaturlos, klanglos; sie war auch blind, taub, gefühllos. In absoluter Dunkelheit tobten qualitätslose Massen durcheinander. Erst durch das Bewußtsein erhält die Welt Farben, Wärme, Klang, erst im Bewußtsein wird die vorher blinde und taube Welt sehend, hörend und überhaupt wahrnehmend und wissend.
Diese Tatsache, daß durch das Bewußtsein etwas ganz Neues in der Welt erscheint, daß sie nicht bloß „Dasein“ hat, sondern auch „Bewußtsein“, daß sie im Menschen gewußt und wissend ist, gibt die Berechtigung dafür, daß die Philosophen das Bewußtsein seit je gegenüber dem bloßen Dasein auch höher gewertet haben, daß Seele und Geist, die Träger des Bewußtseins, als vornehmer im Rang galten als die Materie, ja daß sie sogar vielfach gar nicht zur „Welt“ gerechnet, sondern für überweltlich-göttlichen Wesens angesehen wurden. Und auf jeden Fall setzt die Welt als Bewußtseinswelt auch ein Weltbewußtsein voraus; und selbst wenn allein der Mensch im gesamten Kosmos Bewußtsein hätte, wäre doch sein Bewußtsein auch ein Weltbewußtsein, obwohl keineswegs beweisbar ist, daß alles Bewußtsein in der Welt sich nur in irdischen Menschenhirnen abspielt. Denken wir alles Bewußtsein in der Welt hinweg, so wird sie zu einem gespenstigen, sinnlosen Spuk wie ein Konzert, das von Automaten in völlig leerem Saal aufgeführt würde. Daß sie mehr ist, wenigstens für den Menschen, beruht auf seinem Bewußtsein.
Das Wissende und das Gewußte in der Welt
Ehe ich jedoch die großen philosophischen Fragen aufrolle, die sich je nach der Bedeutung, die man dem Bewußtwerden der Welt zumißt, mit Notwendigkeit ergeben, ist eine kurze logische Erklärung des so gewichtigen Wörtchens „bewußt“ notwendig. Ich lasse dabei den Begriff „Bewußt-sein“ zunächst beiseite, der im Deutschen erst im achtzehnten Jahrhundert aufgetaucht ist, und zwar als Übersetzung des griechischen Wortes „syneidesis“, das ins Lateinische als [072] „conscientia“ übertragen wurde. Das Wort „bewußt“ ist jedoch aus der lebendigen Sprache erwachsen, aber trotzdem nicht ganz eindeutig sondern doppelsinnig, obwohl der Doppelsinn nicht zufällig ist.
Denn man braucht den Begriff „bewußt“ manchmal in aktivem, mehr subjektivem, manchmal auch in passivem, mehr objektivem Sinne. Man meint damit manchmal „wissend“ und manchmal „gewußt“. Wir sagen, ein Mensch sei oder handle „bewußt“, wollen aber damit zum Ausdruck bringen, daß er „wissend“ sei oder handle; gemeint also ist ein aktiver, wesentlich subjektiver Tatbestand. Daneben aber sagen wir auch, ein Gegenstand sei oder werde uns „bewußt“, und wir meinen damit nicht, daß er wissend, sondern daß er gewußt sei, wobei wir also das Wort „bewußt“ in passivem, mehr objektivem Sinne brauchen. Gewiß können durch diesen Doppelsinn Irrtümer entstehen, und doch ist er insofern berechtigt, als zumeist, wo aktives Wissen erlebt wird, dies sich auch auf ein Objekt richtet, das eben dadurch „gewußt“ wird; und überall, wo wir einen Gegenstand passiv „bewußt“ nennen, muß auch ein aktives Subjekt hinzugedacht werden, das wissend ist. Daß man jedoch wissend sein kann um ein Objekt, setzt voraus, daß dieses „wißbar“ sei, daß es, was es auch sonst sein mag, so beschaffen sein muß, daß es gewußt werden kann. Das aber ist keineswegs selbstverständlich, obwohl man es, sogar vielfach in der Philosophie, als selbstverständlich hingenommen hat. Es ist jedoch eine große Frage, ob die Gesamtwelt wirklich wißbar ist, nicht bloß ob ihrer Größenmaße, sondern weil es vielleicht Tatbestände gibt, die prinzipiell allem menschlichen Wissen unzugänglich sind.
Indessen liegt es nicht so, daß die Welt sich da, wo sie uns bewußt wird, wirklich völlig passiv verhielte, so wie – nach Laienmeinung – eine Landschaft, die durch einen Scheinwerfer beleuchtet wird. Tatsächlich widerlegt schon dieses Beispiel die Falschheit der Meinung, die Gegenstände und die Welt verhielten sich passiv; denn wenn wir den vom Scheinwerfer bestrahlten Gegenstand sehen, so beruht das nur darauf, daß der Gegenstand die auf ihn gerichteten Strahlen zum Teil in unser Auge zurücksendet. Und genau so ist's, wenn wir einen Gegenstand oder die Welt bei Tageslicht sehen: auch hier ist das Sehen nicht bloß Leistung unseres Auges, sondern auch der Gegenstände, die einen Teil der auf sie fallenden Strahlen, gesiebt je nach der „Färbung“ des Gegenstandes, d. h. seiner spezifischen Oberflächenbeschaffenheit, in unser Auge schicken. Nicht nur unser fälschlich als Passivum bezeichnetes „Bewußtsein“ ist eine Aktivität, auch die „Wißbarkeit“, die Wahrnehmbarkeit der Gegenstände, beruht auf Aktivität. Das Bewußtwerden der Welt ist also nicht bloß eine Leistung des wissenden Subjekts, sondern auch eine aktive Leistung der gewußten und wißbaren Welt, was in der Philosophie zumeist ganz übersehen wird.
Indem wir die Frage nach der Bewußtheit der Welt stellen, fragen wir also erstens, ob und wieweit die Welt wissend sei, und wir fragen zweitens, ob und wieweit die Welt wißbar, also [073] Gegenstand der Bewußtheit sei oder doch werden könne. Beide Fragen sind nicht zu trennen, obwohl dabei die ungeheuere Diskrepanz bleibt, daß wir als „wissend“ in der Welt nur die im Vergleich zum Weltganzen winzigen Lebewesen kennen, während wißbar, „gewußt“ im objektiven Sinne doch das Weltganze sein soll.
Mit unserer Begriffsscheidung erklärt sich auch der Titel unserer Untersuchung. Sprechen wir von Bewußtseinswelt, so meinen wir die Welt, insofern sie „bewußt“ im Sinne von „gewußt“ ist, wobei wir als Subjekt des Wissens zunächst den Menschen setzen. Sprechen wir jedoch von Weltbewußtsein, so meinen wir damit das Problem, wie weit die Welt „bewußt“ im Sinne von „wissend“ sei. Auch diese Frage kann vorläufig nur dahin beantwortet werden, daß „der Mensch“ – soweit wir sehen – alles Weltbewußtsein repräsentiert, da die Tiere, wenn auch vielleicht Bewußtsein, doch kaum ein Weltbewußtsein haben dürften.
Indessen geht die Problemstellung weiter. Da der Mensch allenthalben, insbesondere jeder Art von Unendlichkeit gegenüber, auf Grenzen seines Wissens stößt, so wird ihm klar, daß die ganze menschliche Bewußtseinswelt nicht ein Bewußtsein von der ganzen Welt ist. Und zugleich taucht damit die Frage auf, ob das menschliche Wissen auch das einzige Weltbewußtsein sei, was insbesondere ob der Kleinheit des Menschen gegenüber den Riesenmassen der Welt als sehr zweifelhaft erscheint. Es hat daher seit alters die Vermutung, ja, der feste Glaube bestanden, es gäbe über das menschliche Bewußtsein hinaus ein „Weltbewußtsein“, das wirklich die ganze Welt umspanne. Man kann sich schwer vorstellen, daß das Bewußtsein im Einzelmenschen gleichsam aus dem Nichts „entspränge“, sondern man meint, es müsse, wie jeder Wasserquell auf der Erde letztlich aus dem Ozean stammt und gespeist wird, auch ein Gesamtbewußtsein geben, aus dem die Einzelbewußtseine der Menschen herkämen wie die Quellen aus dem Weltmeer.
Aber einerlei, welchen Umfang man der Tatsache des Wissendseins zubilligt, wie weit man die Welt „wissend“ nennen darf und welchen Umfang man der Wißbarkeit, ihrer Fähigkeit, gewußt zu werden, zuerteilt, dahinter reckt sich das Problem auf, ob und wieweit das Wissende und das Gewußte als Einheit anzusehen sind. In unserer Formulierung würde das heißen: ob und wieweit die Bewußtseinswelt mit dem Weltbewußtsein identisch sei, was – in religiöser Formulierung – der Pantheismus bejaht, der das Weltbewußtsein „Gott“ nennt und mit der gewußten Welt gleichsetzt. Dagegen trennt der Theismus Gott und Welt, indem er das göttliche Bewußtsein der „Welt“ gegenüberstellt, die er nur als Schöpfung des göttlichen Bewußtseins ansieht. Daneben besteht jedoch noch ein Panentheismus, der die Welt als im göttlichen Bewußtsein bestehend denkt.
[074]
Wissen und Werten
Indessen, wenn wir den Begriff „bewußt“ auf das Tätigkeitswort „wissen“ zurückführen, ist damit der Tatbestand noch nicht aufgehellt. Obwohl jeder „weiß“ oder zu wissen glaubt, was mit „Wissen“ gemeint ist, bleibt es doch eine in ihren Tiefen höchst rätselhafte, mit nichts aus der Objektwelt zu erklärende Tatsache, daß wir um Dinge, die nicht zu unserem Ich gehören, ja, die ihm vielfach sogar sehr fern und feindlich gegenüberstehen, „wissen“ können, womit wir meinen, daß sie außer ihrer realen Existenz noch eine zweite ganz andere Existenz in unserem Kopfe hätten, die ihnen aber dennoch irgendwie entspricht, wodurch wir die Dinge, wie die Sprache sagt, erfassen oder begreifen. Damit übertragen wir allerdings auf das Bewußtsein in bildnishafter Redeweise Vorstellungen von realen Tätigkeiten, die ein körperliches Verhalten bezeichnen, das jedoch dem gemeinten Tatbestand nur wenig gerecht wird. Denn wissendes „Erfassen“ ist etwas ganz anderes als das Erfassen mit der Hand, obwohl es mit der Hand und dem „Handeln“ in weit engerem Zusammenhang steht, als gemeinhin angenommen wird.
Auch sonst hat man versucht, sich das „Wissen“ durch Gleichnisse aus der realen Welt klarzumachen. Man nennt es ein Abspiegeln der Welt, wobei man an die bekannte Tatsache erinnert, daß im Wasser oder auf präparierten Glasflächen die Gegenstände wenigstens in ihrer Form verdoppelt auftreten. Auch nennt man das Wissen oft ein Abbilden; man sagt, wenn man etwas weiß, man habe ein „Bild“ von dem Gegenstande, womit ebenfalls zwar die Verdoppelung illustriert wird, aber nicht das Wesentliche des Wissens, die Beziehung des „Bildes“ auf den Gegenstand, die auch beim Spiegel wie beim gemalten Bilde nur durch das hinzukommende Bewußtsein des Menschen hergestellt wird.
Alle solchen Vergleiche sind also unzulänglich, und es hilft nichts, wir müssen das „Wissen“ als ein „Urphänomen“, das nicht weiter zu erklären ist. hinnehmen; und wir können das, weil wir es aus eigenem Erleben kennen, auch wenn wir es nicht auf andere Tatsachen zurückzuführen vermögen. Höchstens läßt sich aussagen, daß in allem Wissen eine Beziehung hergestellt wird zwischen einem wissenden Subjekt und einem gewußten Objekt, das „beigewußt“ wird; denn die Vorsilbe „be“ im Worte „bewußt“ ist eine Abschwächung von „bei“. Beigewußt wird im Wissen jedoch nicht bloß das Objekt durch das es wissende Subjekt, sondern auch alles „Wissen“, das im Gedächtnis aufbewahrt wird, wird beigewußt, wobei die Wahrnehmung des Objekts mit ähnlichen Erinnerungen zu einem „Begriff“ (verkürzt aus Bei-griff) zusammengefaßt, zugleich aber auch von allen übrigen Erinnerungen unterschieden wird, deren Vorhandensein und Wirksamwerden allein als eine selbst nicht klar bewußte Folie erst eine Unterscheidung ermöglicht.
Damit aber kompliziert sich die ganze Problematik noch mehr, insofern gerade das, was wir „Wissen“ nennen, in seiner Hauptmasse [75] nicht immer bewußt, sondern zumeist unbewußt oder doch unterbewußt ist, wenn es auch jederzeit bewußt gemacht werden kann. Während ich schreibe, ist alles, was ich über mein eigenes Leben und das meiner Bekannten „weiß“, was ich von Geschichte oder Biologie und allen anderen Wissenschaften „weiß“, mir durchaus nicht in den Tausenden von Einzelheiten bewußt; es bildet höchstens einen Hintergrund des Bewußtseins, liegt in Reserve, wie die weitgestaffelten Etappen hinter der kämpfenden Truppe, allerdings stets bereit, einzugreifen ins Bewußtsein.
In die tiefste Problematik des Begriffs Bewußtsein führt jedoch erst die Einsicht, daß damit keineswegs immer ein „Wissen“ im vollen Sinne eines „wahren“, dem Gegenstand adäquaten Wissens bezeichnet wird, sondern daß man zum Bewußtsein auch Erlebnisse rechnet, die entweder, wie das Fühlen und Streben, überhaupt kein Wissen im vollen Sinne, oder wie Phantasievorstellungen oder Irrtümer nachweisbar unadäquates Wissen sind. Es muß sehr ernsthaft die Frage gestellt werden, ob das Wissen im Sinne adäquaten Erkennens überhaupt das Wesen aller jener höchst verschiedenartigen Erscheinungen ausmacht, die wir einseitig nach ihm als Be„wußt“sein bezeichnen. Viele Richtungen der neueren Psychologie haben das – wenigstens in ihrer Praxis – verneint, wenn sie der älteren intellektualistischen Seelentheorie eine emotionalistische oder voluntaristische gegenüberstellen, also daß es sich, wenn diese Wortbildungen erlaubt sind, gar nicht um ein Bewissendsein, sondern um ein Befühlend oder ein Bewollendsein handelt; und gar die aktivistische Psychologie, die das Bewußtsein als Wirken auffaßt, müßte begrifflich exakt nicht von Bewußtsein, sondern von Bewirkendsein sprechen.
Fassen wir das Fühlen, das Wollen, das Wirken, da darin stets eine Bewertung mitspricht, als Wertung zusammen, und fügen wir hinzu, daß auch in allem Wissen eine Bewertung steckt, so würden besser als die Worte Wissend- und Gewußt-sein die Bezeichnungen Wertend- und Gewertet-sein den wahren Tatbestand treffen. Unser Bewußtsein von der Welt ist weit über das Wissen hinaus und ein Werten, so wenn wir die Welt als „schön“ oder „häßlich“, als „gut“ oder „schlecht“, sogar als die „beste“ oder die „schlechteste“ Welt, wie das einzelne Philosophen getan haben, beurteilen. Es gibt Weltangst und Weltfreudigkeit, Weltverneinung und Weltbejahung, man kann die Welt „lieben“ oder „hassen“, was alles keineswegs ein adäquates „Wissen“ von der Welt voraussetzt, sondern oft bei sehr unzulänglichem, ja falschem Wissen von der Welt geschieht.
Es ist nun höchst sonderbar, daß die älteren Philosophen, wenn sie von Bewußtsein reden, dabei fast ausschließlich an ein adäquates, „wahres“ Wissen von der Welt denken. Daneben beachten sie kaum das Fühlen, die freie Phantasie, das Wollen, die, auch wenn sie meist mit einem objektgerichteten, aber nicht immer objektgerechten „Wissen“ verbunden auftreten, jedenfalls etwas anderes sind als „wahres“ [076] Wissen. Die Philosophen haben auch wenig die un- oder doch unterbewußten Faktoren, die in alles bewußte Wissen eingehen, beachtet Und sie sind sich vor allem selten klar gewesen, daß das, was die Menschen früherer Jahrhunderte ihr Wissen oder die „Wahrheit“ nannten, sich schon heute im Rückblick als Irrtum oder doch mit Irrtümern verquickt darstellt, also daß auch wir nicht mit Sicherheit sagen können, ob das, was uns als „Wahrheit“ gilt, wirklich wahres Wissen ist. Zudem aber ist die „Wahrheit“ selbst ja nicht ein bloßes Wissen, sondern eine Wertung; denn wenn wir eine Meinung als wahr oder als irrig beurteilen, so werten wir sie, oft nur auf Grund ganz unbeweisbarer Gefühle, und wer eine Wahrheit gefunden hat, hat damit einen Wert gefunden.
Jenes Urphänomen, das wir durch das Wort „Bewußtsein“ bezeichnen, ergibt sich also, unter kritische Lupe genommen, als höchst verwickelter und widersprüchlicher Tatbestand, vor allem dadurch, daß das „Bewußtsein“ als Sammelbegriff aller seelisch-geistigen Erlebnisse höchstens zum Teil ein Wissen im strengen Sinn als adäquater „Abbildung“ der Objekte ist, vielmehr teils ein falsches Wissen, teils überhaupt kein Wissen, sondern ein Werten. Wenn wir schon in einer „Bewußtseinswelt“ leben, so ist diese doch keineswegs eine „wahr“ gewußte Welt; und das „Weltbewußtsein“, soweit es im Menschen wirkt, ist nicht bloß ein Wissen, sondern ein Werten, ist eine Weltwertung. Das zeigt sich vor allem darin, daß die weitaus größte Mehrheit aller Bewußtseinsakte sich ja eingliedert in ein komplexeres Verhalten, ein Handeln und Wirken, das auf Abänderung irgendwelcher Teile der Welt gerichtet ist, insbesondere dort, wo es sich in den Dienst der Kultur stellt, also daß wir das Bewußtsein später als Funktion des Kulturstrebens des Menschen erweisen werden. Aber schon jetzt läßt sich sagen, daß wir, indem wir ästhetisch die Welt genießen oder sie durch Begriffe verständlich machen oder sie mit religiösen Gefühlen betrachten, die Welt damit nicht nur in ihrer „Gegebenheit“ hinnehmen, sondern ihr auch Werte zuteilen, die ihr „an sich“ nicht zukommen, die wir auf Grund unseres Bewußtseins herantragen. Unser „Bewußtsein“ von der Welt ist nicht „gegeben“, ist nicht Natur, sondern geschaffen, ist Kultur. Und die Kultur als Gesamtphänomen genommen ist nicht ein Wissen von der Welt, sondern ein schöpferisches Gestalten der Welt, dem sich das Wissen, auch das Wahrwissen, unterordnet.
Das Bewußt-Sein als wissendes Sein und gewußtes Sein
In der Philosophie sind nun die aus dem unmittelbaren Erleben hervorgegangenen Begriffe des „Wissens“ und des „Bewußten“ zum Begriff des „Bewußt-Seins“ substantiviert und substantialisiert worden, indem man hinter der Tätigkeit des Wissens und der Eigenschaft „bewußt“ ein wissendes Sein suchte, das jedoch, indem es sich selbst zum Gegenstand macht, auch „gewußt“ werden könne, eine [077] Komplikation, die in der älteren Philosophie als „Selbstbewußtsein“ bezeichnet wird.
Daß man hinter dem Wissen ein Etwas vermutete, das weiß und fühlt und die Handlungen leitet, ist freilich weit älter als der Begriff des „Bewußtseins“; in fast allen Kulturen besteht dafür der Begriff der Seele, die als vom Leibe trennbar gedacht wird. Denn daß nicht der Leib weiß und fühlt, glaubte man daraus schließen zu müssen, daß im Schlaf und nach dem Sterben, wo ja zunächst der Leib noch existiert, dennoch der Mensch nicht bewußt ist. Die im Leibe wohnende Seele dachte man sich als Atem oder als Schatten, um ihre Nichtmaterialität verständlich zu machen; und in der Tat bedeuten in vielen Sprachen die Worte für „Seele“ oder „Geist“ ursprünglich „Atem“ oder „Luft“, und man spricht noch heute davon, daß jemand seine Seele „aushauche“.
Als jedoch diese primitiven Gleichsetzungen der „Seele“ mit dem Atem sich als unhaltbar erwiesen, suchte man nach einem anderen Begriff für das wissende Etwas und konstruierte das Wort „Bewußtsein“, womit in erster Linie das wissende Sein gemeint ist, das von sich selbst wissen kann und damit sich selbst, wenn auch nur in höchst unvollkommener Weise, „gewußt“ machen kann. Indes ist das sogenannte „Selb[s]tbewußtsein“ im philosophischen wie im alltäglichen Sinne zumeist eine „Selbsttäuschung“, mehr ein Fühlen als adäquates Wissen. Daran ändert auch die Psychologie nichts, die die „Bewußtseinserscheinungen“ zwar klassifiziert und ihre Zusammenhänge klarzulegen sucht, aber über das Wesen des wissenden Seins, der „Seele“, bisher recht wenig ermittelt hat.
Als im achtzehnten Jahrhundert das Wort Bewußt-Sein (vielfach auch so geschrieben) aufkam, dachte man dabei jedoch vielfach nicht bloß an das wissende Sein, sondern an das gewußte oder das „wißbare“ und „zu wissende“ Sein. Dieses wißbare „Sein“ wird meist in der Philosophie, z. B. von Descartes, vollkommen vom wissenden Sein getrennt, also daß es ihm als ganz andere „Substanz“ gilt, wie ja auch die populäre Meinung der „Seele“ eine von der Materie völlig verschiedene „Substanz“ zuweist. Aber selbst wenn wir das gewußte oder zu wissende Sein mit der Materie gleichsetzen und das wissende Sein als ein immaterielles Etwas, als Seele, denken, bleibt doch das Problem, wie das wissende Sein, die Seele, vom zu wissenden Sein, der Materie, wissen kann. Es muß eine Verbindung bestehen, auf Grund deren die Seele von der Materie wissen kann, auch ganz abgesehen davon, daß wir eine Seele, ein wissendes Sein, nur in Verbindung mit dem materiellen Leibe kennen. Jene Verbindung zwischen wissendem Sein und gewußtem Sein, der Materie, besteht nun in der Tat, und zwar nicht bloß als einseitige Aktivität der Seele, sondern als doppelseitige Beziehung, insofern die Materie sich nicht bloß als passives Sein, sondern als ein höchst aktives Geschehen darstellt, was wir schon gestreift haben.
Jedenfalls ist es eine falsche Auffassung, die auch von den meisten Philosophen geteilt wird, daß das Bewußtwerden der Welt ein [078] Geschehen sei, bei dem die ganze Aktivität im Menschen liege, als handele es sich um ein „Erfassen“ oder „Begreifen“, wobei sich das Objekt völlig passiv verhalte. Schon die Tatsache, daß das Wissen daneben als passives Verhalten, als „Abspiegeln“ gedacht wird, weist die Aktivität dem Objekt zu. Jedenfalls kommt die Welt dem Erfaßtwerden entgegen, sie gibt Kunde von sich, sie meldet ihr „Dasein“ auch an Stellen an, wo sie nicht „da-ist“. Das Sichtbarwerden der Dinge und sogar fernster Sterne setzt voraus, daß die Objekte Strahlen aussenden, die in menschlichen Augen Farbenempfindungen auslösen. Und wenn man das nicht als Angelegtheit auf den Menschen gelten lassen will, so ist doch heute von den Biologen eingesehen, daß z. B. die Blumen und Früchte durch leuchtende Farben, angenehmen Duft und süßen Geschmack Tiere „anlocken“, womit sie also deren Bewußtsein entgegenkommen. Das Verhältnis zwischen wissendem und gewußtem Sein ist ein doppelseitiges Entgegenkommen, wie – wenn ein halb scherzhafter Vergleich erlaubt ist – die „Werbung“ zwischen männlichem und weiblichem Geschlecht bei Tier und Mensch. Dies Verhältnis faßt oberflächliche Beobachtung nur als Aktivität auf seiten des Mannes auf, während in Wahrheit oft auch das weibliche Geschlecht, selbst dort, wo es sich scheinbar gleichgültig, ja auch wo es sich abweisend verhält, sich sehr aktiv beteiligt; zumeist jedoch handelt es sich um ein „Entgegenkommen“. – Daß es sich beim Verhältnis zwischen Seele und Materie, zwischen Subjekt und Objekt, also zwischen wissendem und zu wissendem, wißbarem Sein ebenfalls um doppeltes Entgegenkommen handelt, ist in der Erkenntnisphilosophie nirgend genügend betont worden. Aber es ist so, und alles, was wir Sehen, Hören, Riechen nennen, ist nicht bloß eine Aktivität der Seele, sondern setzt „Reize“ seitens der Objekte voraus, wobei der sprachliche Ausdruck bereits an die erotische Beziehung, die „Reize“ der Frau erinnert, die aktiv „werben“.
Noch deutlicher dürfte der Tatbestand der Doppelseitigkeit werden, wenn man einbezieht, daß die zu wissende Welt ja gar nicht bloß aus Materie besteht, nicht bloß aus „Dingen“, wie Kant zumeist ziemlich gröblich sagt, sondern aus lebenden und selbst wissenden Wesen. Hier tritt die Aktivität der „Objekte“ besonders deutlich in dem heraus, was man zusammenfassend als „Ausdruck“ bezeichnet. Dadurch nämlich geben Tiere wie Menschen beständig Kunde von ihrem Leben und ihrem Bewußtsein, teils unwillentlich, teils sogar willentlich. Und dieser „Ausdruck“ wird durch „Einfühlung“ verstanden, wobei man oft dem Ausdruck mehr „Bewußtsein“ zuschreibt, als ihm zukommt, insofern der Mensch zum Beispiel den Instinkthandlungen der Tiere ein Zweckbewußtsein unterschiebt, das sie gar nicht haben können. Beim Menschen besteht über die Ausdrucksmöglichkeiten der Tiere hinaus noch die Begriffssprache, durch die sich uns das Bewußtsein fremder Subjekte noch weitergehend erschließt als im sonstigen körperlichen Ausdruck.
Jedenfalls ist sicher, daß das Verhältnis zwischen Bewußtheit und Welt, zwischen Seele und Materie, zwischen Subjekt und Objekt, [079] zwischen wissendem und wertendem Sein einerseits und gewußtem und gewertetem Sein andererseits nicht das eines radikalen Gegensatzes ist, sondern ein höchst kompliziertes Ergänzungsverhältnis, in dem das wissensfähige Sein mit dem wißbaren Sein jene Einheit eingeht, die wir im zugleich subjektiven und objektbezogenen Sinne „Bewußtsein“ nennen. Denn so mangelhaft diese[s] künstlich zurechtgezimmerte Wort sein mag, es hat sich so eingebürgert, daß auch wir es benutzen müssen, wobei allerdings alle eben dargelegten Vorbehalte zu machen sind, vor allem der, daß unser Bewußtsein nur zum Teil wahres Wissen ist, daß es aber zugleich mehr ist als bloßes Wissen um die Welt, die es nicht abbildet, sondern umbildet.
Das menschliche Bewußtsein als kosmischer Tatbestand
So verwunderlich es dem vorwissenschaftlichen Menschen vorkommen mag, daß die Philosophie soviel Aufhebens macht von dem – angesichts der ungeheuren Größe des Weltalls – so winzigen Bewußtsein, das, wie man meint, nur in Menschenköpfen existiert, so bleibt dennoch die Tatsache, daß der Mensch um die Größe dieses Weltalls nur durch dies kleine Bewußtsein weiß, und daß, so gering und begrenzt es sein mag, das menschliche Bewußtsein doch zur Welt gehört, also daß es schon darum eine kosmische Tatsache ist.
Denn selbst wenn wirklich nur auf unserer kleinen Erde bewußte Wesen im gesamten Weltall existierten und selbst auf der Erde nur seit einigen Jahrhunderttausenden und vielleicht auch in der Zukunft nicht länger, ja selbst wenn es auf der Erde nur einen einzigen Menschen gäbe, der Bewußtsein hätte, trotzdem wäre dann das Bewußtsein ein kosmischer Tatbestand; denn damit gäbe es doch in der Welt Bewußtsein und wenigstens in diesem einen Menschen wäre zugleich die Welt wissend und, wenn auch nur in grobem Umrissen, „gewußt“, Gegenstand eines Bewußtseins. Sagt die Sprache doch, obwohl das Bewußtsein direkt nur an die Vorgänge in gewissen Großhirnganglien des Menschen gebunden ist, trotzdem nicht, das Großhirn, sondern der Mensch sei wissend, und mit Recht, weil der gesamte Organismus eine indirekte Voraussetzung des Bestehens und Funktionierens der Hirnzellen ist; so können wir auch sagen, die Erde, ja, der ganze Kosmos sei im Menschen wissend, weil die Erde, ja, der gesamte Kosmos indirekte Voraussetzungen für das Bestehen des Menschen und damit seines Bewußtseins sind.
Aber auch in objektiver Hinsicht ist das Bewußtsein, selbst wenn es nur in Menschenhirnen aufleuchtete, ein kosmischer Tatbestand, damit die Welt als Ganzes bewußt im Sinne von „gewußt“ wird, so unzulänglich dies Wissen auch sein mag. Denn das Bewußtsein dringt ja allenthalben über das Gehirn hinaus, es hat nicht nur die gesamte Erde zu seinem Gegenstand gemacht, es überwindet die unvorstellbar weiten Entfernungen des Raums, indem es sich zu den [080] Sternen erhebt; und weiter noch als das Auge dringen das Denken und die Phantasie, die keinerlei Grenzen kennen. Gewiß werden nicht alle Einzelheiten der Welt klar erkannt; es handelt sich nicht um klare Weltanschauung, nur um ein Weltgefühl, aber doch um ein Weltgefühl, in dem das Weltganze mindestens als dunkles Problem erlebt wird. Daß wir von einem Kosmos sprechen, ist nur möglich, weil das Bewußtsein ein kosmischer, ein auf den Kosmos ausgerichteter Tatbestand ist, und weil der außerbewußte Kosmos seinerseits so angelegt ist, daß er Gegenstand des Bewußtseins werden kann, also „bewißbar“ ist. So unsagbar fern die Spiralnebel von uns sein mögen, also daß die von ihnen ausgesandten Lichtstrahlen, die in der Sekunde 300 000 km durcheilen, Jahrtausende brauchen, um zu uns zu gelangen, die Nebel senden doch diese Strahlung aus, so daß sie mit Hilfe unseres Fernrohrs uns bewußt werden können. Auch das ist eine kosmische Tatsache, erstaunlich in höchstem Maße, daß ein Mensch, der nachts gen Himmel blickt, das Dasein von Tausenden unvorstellbar ferner, riesiger Sonnen in seinem Auge und Hirn konzentrierend „wissend“ zu erleben vermag.
Gerade aber der Größengegensatz zwischen den winzigen wissenden Subjekten des Bewußtseins und der ungeheuerlichen Weite der Bewußtheitsobjekte, die, soweit sie nicht bewußt sind, doch bewußt werden können, ist ein starker Antrieb der Philosophie gewesen, auch wenn man sich darüber nicht immer klar war. Denn daraus erwächst nicht nur in der Philosophie, sondern auch in den Religionen das Bestreben, der unendlichen gewußten Welt ein ebenso unendliches wissendes Weltbewußtsein neben-, ja überzuordnen. Und seit frühesten Zeiten hat der Mensch zu der gewaltigen gewußten Weltobjektivität auch ein ebenso gewaltiges, ja noch gewaltigeres wissendes Weltsubjekt hinzugedacht, das er mit dem höchsten Namen nannte, über den er verfügt: Gott. Es schien ihm unmöglich, daß das Bewußtsein, das die Welt zu denken, ja zu beherrschen vermag, allein in den Köpfen der Menschen aufleuchten sollte, während der übrige Kosmos unbewußt, seelenlos wäre. Und so kam man dazu, auch scheinbar tote Dinge, die Gestirne, ja die ganze Welt beseelt zu denken.
Das Bewußtsein im Streit der Philosophen
Befragen wir nun die historischen Systeme der Philosophie, so tritt uns eine überraschende Tatsache entgegen. Die Probleme, die wir zunächst anschlugen, um die Begriffe Wissen und Bewußtsein zu klären, das Verhältnis der wissenden Subjekte zu den gewußten Objekten, beschäftigen viele Philosophen überhaupt nicht, vielmehr nehmen sie das Bewußtsein im Sinne des Wissens als Gegebenheit, ja als einzige Gegebenheit, und erklären die vom gewöhnlichen Denken als „Gegenstand“ des Bewußtseins angenommene Welt nur als „Inhalt“ des Bewußtseins, ja geradezu als Täuschung, also daß ihr Wirklichkeit nur soweit zukomme, wie etwa den Gebilden eines Traumes. Das, was [081] dem nichtphilosophischen Denken als Wirklichkeit, als „Welt“ erscheint, wäre danach nichts als ein Traumgebilde des allein bestehenden Bewußtseins, des „Denkens“, wie man gewöhnlich einengend sagt. Das sogenannte „Sein“ der Welt bestünde nur in ihrem Gedachtwerden. Aber nicht bloß die Objektwelt erscheint als Traumgebilde, als bloßer Denkinhalt, auch das denkende Subjekt als Individuum gilt nur als Vorstellung und, wenn es für Realität genommen wird, als Irrtum. Allein existierend soll nur das „Bewußtsein an sich“, das „Denken überhaupt“, ein „kosmisches Bewußtsein“, die Gottheit sein.
Man bezeichnet diese Richtung der Philosophie mit sekundären Nuancen bald als Idealismus, bald als Spiritualismus, bald als Rationalismus. Hierzu rechnen die Weltbilder der indischen Upanishaden und der frühgriechischen Eleaten, die eine Wirklichkeit jenseits des Denkens als Trug, als Nichtsein behandeln. In neuerer Zeit hat Leibniz die Außenwelt als bloße Vorstellung der „Monaden“, der Seelen, erklärt. Kants Meinung in dieser Frage ist umstritten, aber viele seiner Anhänger behaupten, er habe dem jenseits der bewußten Erscheinungen angenommenen „Ding an sich“ ebenfalls keine Realität zugebilligt. Auch bei Fichte und Hegel gilt die Wirklichkeit nur als Schöpfung des Geistes, und für Schopenhauer ist die Welt „Vorstellung“ des allein wirklichen Willens. Bis in die Gegenwart hinein fehlt es nicht an Denkern, die alle Wirklichkeit nur als Inhalt des Bewußtseins oder des Denkens gelten lassen.
In schroffem Gegensatz zu diesen Philosophen, die alle, wenn auch in verschiedener Weise, die wissende Subjektivität betonen und alles Objektive dem Bewußtsein ein- oder doch unterordnen, stehen die Materialisten, die vielfach das Bewußtsein in der Welt nur insofern beachten, als sie versuchen, es möglichst auszuschalten und der Objektivität, die sie als „Materie“ fassen, ein- oder unterzuordnen. „Wirklich“ ist für sie nur die „Materie“, der räumliche, in der Zeit beharrende „Stoff“ mit seinen Bewegungen, während sie im Bewußtsein eine Nebenerscheinung der Materie sehen. Die Reihe der materialistischen Denker ist kaum weniger lang als die der idealistischen. Materialistisch dachten im alten Indien die Sankhya-Philosophen, in Griechenland die ersten jonischen Denker, vor allem aber die Atomisten, wie Demokrit, und die an diese sich anschließenden Epikuräer, auch, obgleich mit Vorbehalten, die Stoiker. In neuerer Zeit ist ein krasser Materialist vor allem in dem Engländer Hobbes erstanden; materialistisch waren ferner viele Philosophen der Aufklärungszeit, besonders in Frankreich; und in Deutschland hat es im neunzehnten Jahrhundert sehr radikale Materialisten gegeben, die mit Büchner die Welt nur als „Kraft und Stoff“ ansahen und alles Bewußtsein als „Bewegung“ erklärten. Das Paradoxe in vielen materialistischen Systemen freilich ist, daß sie, um das Bewußtsein oder den Geist aus der Materie heraus erklären zu können, ihn vorher hineinlegen und der Materie selbst, wenn auch in ganz dumpfer Form, Empfinden zusprechen, also daß viele Materialisten bei einer Allbeseelung ankommen, wodurch [082] der Begriff des Bewußtseins fast ebenso umfassend gedacht wird wie bei den idealistischen Verkündern eines Allgeistes. Wir haben keinen Anlaß, den radikalen Materialismus, der dem Bewußtsein in seiner Besonderheit nicht gerecht wird, eingehend zu behandeln. Denn eine Philosophie, die den Eigencharakter des Bewußtseins ableugnet, das doch Voraussetzung dafür ist, daß man den Begriff Materie denkt, sägt den Ast ab, auf dem sie sitzt. Und wenn jemand glaubt, Denken sei Bewegung, so ist mit ihm so wenig zu streiten, als wenn ein Geisteskranker behauptet, er sei der liebe Gott; jene Gleichsetzung ist auch damit nicht erwiesen, daß man heute überzeugt ist, daß bei allem Denken Bewegungsprozesse mitspielen, was jedoch von Identität weit entfernt ist. Wird aber der Materie Bewußtsein, wenn auch nur als Nebenphänomen zugeschrieben, so ist die Materie nicht mehr Materie in strengem Sinn, und der Materialismus kein Materialismus.
Neben extremen Idealisten und extremen Materialisten hat es jedoch stets auch Dualisten gegeben, die die Gesamtwelt in zwei Teile spalteten; einerseits Bewußtsein, andererseits „Materie“. Ein radikaler Dualist war der Franzose Descartes, der in der Welt zwei „Substanzen“ unterschied, das „Denken“, wofür er auch „Bewußtsein“ sagt, und die „Materie“ oder „Ausdehnung“, zwei „Substanzen“, die er freilich so auseinanderreißt, daß es recht unklar bleibt, wie das Denken überhaupt zu einem Bewußtsein von der Materie gelangen soll.
Gemäßigtere Dualisten sind alle Realisten, die einerseits wissende Subjekte, andererseits eine außerseelische Objektivität unterscheiden, die den Subjekten wenigstens zum Teil bewußt wird. Realistisch in diesem Sinne denkt der „naive Realismus“ des vor wissenschaftlichen Menschen, der in der Philosophie etwas hochmütig als der „gemeine Mann“ bezeichnet wird. Indessen sind Realisten auch fast alle Vertreter der Einzelwissenschaften, Physiker, Biologen, Historiker, die gar nicht zweifeln, daß es eine Wirklichkeit gäbe, die vom Bewußtsein der Menschen erkannt werden müsse. Als Philosophie freilich kann nur der kritische Realismus gewertet werden, der im Unterschied vom „gemeinen Manne“ weiß, daß das Bewußtsein die Welt nicht „an sich“ erfaßt, sondern nur in Übersetzung in Bewußtseinserlebnisse, also nur, wie sie „erscheint“. Wird der Erscheinungscharakter stark betont, so handelt es sich um „Phänomenalismus“, der zwar jenseits der Erscheinung ein „Ding an sich“ als Realität annimmt, aber dessen Unerkennbarkeit behauptet. Nach Meinung der „realistischen“ Kantianer war Kant ein Phänomenalist. Andere Realisten gehen weiter; sie wissen zwar, daß die Welt, in der wir leben, eine Bewußtseinswelt und nur in ihrer Erscheinung erfaßbar ist; aber sie sind doch überzeugt, daß in der Erscheinung wesentliche Züge einer darin erscheinenden Wirklichkeit, wenn auch nicht die ganze, die absolute Wirklichkeit, erfaßt werden. Wenn ich hier diesen Standpunkt eines kritischen Realismus einnehme, so geschieht es, weil alles praktische Leben, alle Wissenschaft, alle Kulturarbeit nur möglich ist auf dem Boden eines Realismus, der jedoch, um Philosophie zu sein, die ohne [083] Bedenken angenommene Beziehung zwischen Bewußtsein und Welt tiefer fassen muß, als es gewöhnlich geschieht.
Man sieht, das Problem der Bewußtheit der Welt führt mitten hinein in die zentrale Problematik der Philosophen, die nicht bloß eine Fachangelegenheit ist, sondern seit je tief ins praktische Kulturleben aller Art eingegriffen hat. Die Begriffe „Idealisten“ und „Realisten“ sind sogar in die Umgangssprache übergegangen und kursieren da, allerdings in beträchtlicher Versimpelung. Man nennt auch im Alltag einen Menschen einen „Idealisten“, der sein Denken, Wünschen, Träumen der Wirklichkeit überordnet, und man nennt jemand einen „Realisten“, der in seinem Denken und Planen einer außerbewußten Wirklichkeit Rechnung trägt. Ob jemand sich idealistisch oder realistisch zur Welt stellt, ist nicht Sache freier Wahl, auch nicht rein logische Entscheidung, sondern hängt von der Gesamtveranlagung, dem „Typus“, ab, davon, ob einer mehr im Subjektiven oder mehr im Objektiven lebt, oder, um die Begriffsgegensätze C. G. Jungs zu verwenden, ob er „introvertiert“ oder „extravertiert“ ist. Deshalb hat auch der Streit zwischen Idealisten und Realisten niemals zu endgültiger Entscheidung geführt; es geht diesen Kämpfern wie den feindlichen Brüdern in Heines Gedicht: die sich totschlugen und in jeder Nacht aufs neue kämpften.
Im Grunde handelt es sich bei dem Gegensatz Idealismus und Realismus, so intellektualistisch er zumeist formuliert wird, gar nicht um einen Gegensatz des Wissens, sondern der Wertung, die sich auch auf das Bewußtsein und sein Verhältnis zur Welt erstreckt. Der Idealist stellt das Bewußtsein, den Geist, höher als die gesamte von ihm gewußte Welt, während der Realist die zu wissende Welt höher stellt und dem Bewußtsein nur insofern Wert zubilligt, als es dieser Welt gerecht wird, allerdings nicht nur wissend, sondern auch wertend und wirkend.
Ich selbst nehme hier in dem Streit zwischen Idealisten und Realisten meinerseits Stellung zugunsten eines kritischen Realismus, und zwar darum, weil durch die neuere Forschung der Einzelwissenschaften zahlreiche, gesicherte Ergebnisse erbracht sind, die unmöglich mit einer idealistischen Philosophie zu vereinen sind. Man kann vor dem Idealismus ob seiner Kühnheit, seiner historischen Bedeutung, seines religiösen Schwungs allen gebührenden Respekt haben: mit der heutigen Wissenschaft, insbesondere Biologie, Psychologie und Soziologie, ist er nicht zu vereinen.
Das Allbewußtsein des Idealismus
Wenn ich meiner eigenen Darstellung eine kurze Auseinandersetzung mit dem Idealismus vorausschicke, so geschieht es nicht, um ihn zu „widerlegen“, sondern ihn und seine Position psychologisch verständlich zu machen, zumal in einigen Ergebnissen, wenn auch nicht in ihrer Begründung, unser Weg sich gewissen idealistischen Anschauungen annähern wird.
[084]
In der Geschichte der Philosophie ist gerade der Idealismus überall sehr früh auf dem Plan erschienen, und die anderen Systeme haben sich zum Teil erst im Widerspruch gegen ihn entwickelt. Das muß dem gesunden Menschenverstand erstaunlich scheinen, ebenso wie die andere Tatsache, daß sich überhaupt eine Weltanschauung bilden konnte, die das Bewußtsein, den Geist, als einzige Wirklichkeit in der Welt ansieht und alles, was dem „gemeinen Manne“ als greifbare und oft so gewaltsam sich aufdrängende Wirklichkeit erscheint, für bloßen Inhalt jenes allein existierenden Bewußtseins oder gar für menschlichen Irrtum erklärt. Der Hauptgrund dafür ist ein historischer, daß sich die idealistische Philosophie nachweisbar aus theologischer Spekulation herausgebildet hat, vor allem aus dem Glauben an Götter, d. h. körperlose, rein geistige Wesen, einem Glauben, der sich Überall findet, ehe eine wissenschaftliche Philosophie begann. Zwar die Vielheit der volkstümlichen Götter wurde in fast allen Kulturreligionen sowohl von Theologen wie von Philosophen allmählich auf eine einheitliche Gottheit konzentriert, so in Ägypten, in Indien, in Hellas; selbst in dem betont monotheistischen Judentum verrät die Bezeichnung „Elohim“ (ein Plural), daß polytheistische Anschauungen vorausgegangen waren. Nahm man aber einen einheitlichen Gott an, so war von diesem Glauben der Schritt zu dem abstrakten einheitlichen Weltbewußtsein der Philosophen, wenn man die vermenschlichenden Züge der populären Religionen abstreifte, nicht mehr sehr groß.
Immerhin mußte, wenn man den, bloßen Glauben zur sicheren Erkenntnis, zur Philosophie, ausbauen wollte, das Wissen des Menschen um das Weltbewußtsein, die Gottheit, begründet werden. Da die Sinneserkenntnis, auf die sich der „gemeine Mann“ verläßt, nicht von Göttern sondern nur von der „gemeinen Wirklichkeit“ Kunde gibt, mußte diese als minderwertig, als trügerisch erwiesen werden. Dagegen stellt man das „reine Denken“, die „Vernunft“, in den Vordergrund; der Idealismus wird zum Rationalismus. Das Wissen um den einheitlichen Weltgeist wird als Erkenntnis der reinen Vernunft erklärt, die aus sich heraus, weil in ihr die Weltvernunft wirksam sei, die Wahrheit zu erkennen vermöge. Dabei wird besonders auf die Mathematik verwiesen, deren Erkenntnisse aus reinem Denken erstehen sollen. Die meisten idealistischen Philosophen stützten sich immer wieder auf die Mathematik, weil sie den Beweis liefere, daß es reine, von den Sinnen unabhängige Vernunfterkenntnis gäbe. Plato schrieb über seine Akademie, daß kein Nichtmathematiker eintreten solle, und Spinoza wollte „auf geometrische Weise“ seine Verkündung der allwissenden Weltgottheit begründen. Auch von Descartes, von Leibniz, von Kant wird die Überzeugung vertreten, daß die Mathematik eine von aller Erfahrungserkenntnis unabhängige Vernunfterkenntnis sei. Dieser mathematischen Erkenntnis nun wird die Erkenntnis Gottes, also der einheitlichen Weltvernunft, gleichgeordnet. Das Wissen um ihre Existenz sei eine „angeborene Idee“, jeder Einzelseele innewohnend: so lehren Descartes, Spinoza, Leibniz, während Kant hierin den extremen Rationalismus beträchtlich einschränkt. Hinter jener Lehre [085] steckt der Glaube an den göttlichen Ursprung der menschlichen Seele, die nach ihrer Absonderung von der Weltseele, von Gott, doch ihr Wissen um diese Gottheit bewahre, was sich in dem ihr eingeborenen übernatürlichen „Lichte der Vernunft“ kundgäbe.
Um jedoch die Erhabenheit der reinen Vernunft des Menschen, durch die sich die göttliche Allvernunft offenbart, noch mehr zu heben, werden die Sinneserkenntnis und die in ihr sich erschließende Wirklichkeit möglichst herabgedrückt. Ja, man bestreitet sogar ihren Wirklichkeitscharakter, indem man sie als bloße Erscheinung, wenn nicht gar als Schein erklärt.
Die angeführten drei Hauptkennzeichen des Idealismus, sein Hervorgehen aus der Theologie, die Basierung der Systeme auf die reine Vernunft und die Verwerfung oder doch Herabsetzung der Sinneserkenntnis finden sich, wenn auch ungleich ausgebaut, bei allen Denkern dieser Richtung. Dadurch haben die idealistischen Systeme etwas Kühnes und Großartiges, das seit je begeistert, ja berauscht hat wie große Dichtung. In der Tat sind sie selbst Dichtung und machen auch die Wirklichkeit zur Dichtung, zur freien Schöpfung der Weltvernunft. Dieser transzendente Schwung wirbt der idealistischen Philosophie gegen alle kritischen Einwände immer wieder Anhänger, wozu kommt, daß die Theologen vieler Religionen in der idealistischen Philosophie eine Verstandesbegründung ihrer Dogmen zu finden glaubten und sie daher lebhaft befürwortet haben. Genau besehen aber haben die Theologen wie auch viele Philosophen ihr Allbewußtsein, Gott, nicht bloß als „wissend“, sondern vor allem als wirkend aufgefaßt, als schöpferische Kraft, die mehr ist als bloß „Bewußtsein“.
Das Allbewußtsein und die Individuen
Wenn ich trotz des poetischen und religiösen Schwungs des Idealismus, der gestützt ist durch die historische, oft zur Legende gewordene Autorität zweifellos bedeutender Denker, dennoch wage, ihr großartiges Dogma vom einheitlichen Allbewußtsein anzufechten, so entnehme ich meine Einwände zunächst den Idealisten selbst, die sie, freilich sehr wider Willen, reichlich liefern.
Denn es besteht da zunächst die Tatsache, daß die Idealisten, die sich als erleuchtet von der kosmischen einheitlichen Vernunft und als ihre Sprecher fühlen, dennoch untereinander keineswegs einheitlich sind, sondern sich in sehr wesentlichen Punkten kraß widersprechen. Ungeachtet ihres Grunddogmas sind die Systeme, die diese Denker wie der Inder Yainavalkya oder Fichte, Parmenides oder Leibniz, Plato oder Hegel und andere ausgebaut haben, außerordentlich verschieden. Und wenn sie sich auf ihr „lumen naturale“, auf ihre allgemeingültigen Vernunftwahrheiten berufen, so bleibt merkwürdig, daß diese Offenbarungen so ungleich sind. Wir zweifeln nicht an der subjektiven Wahrhaftigkeit jener Denker; sie mögen ihre mystische Schau einer göttlichen Urvernunft durchaus echt erlebt haben, aber es läßt sich [086] dennoch bezweifeln, ob dieser subjektiven Wahrhaftigkeit eine objektgerechte Wahrheit entspricht. Es kann sich bei ihrem Erleben trotzdem um Selbsttäuschung oder Selbstsuggestion handeln; denn es gibt auch sonst Beispiele genug, daß Denker Ideen, die nachweisbar falsch waren, dennoch mit der subjektiven Überzeugung ihrer Wahrheit mit Leidenschaft verfochten haben, ja sogar dafür in den Tod gegangen sind. Aber auch das ist kein Beweis für die Wahrheit jener Ideen. Und jedenfalls ist es kein Beweis für die Einheitlichkeit der Weltvernunft, wenn ihre Offenbarungen so widersprüchlich sind. Es ist nicht zu leugnen, daß das Wahrheitspathos der Idealisten zuweilen den Eindruck einer gewissen Gewaltsamkeit und Selbstberauschung macht, insofern sie dort, wo die Argumente versagen, durch Bilder und Gleichnisse oder poetische Hymnik mehr zu überreden als streng sachlich zu überzeugen suchen, wenn sie sich nicht in Dunkelheit flüchten, was vielfach bei Fichte, Schelling und Hegel geschieht, bei denen man oft nicht weiß, ob das Ich, von dem da geredet wird, das individuelle Ich oder das Allich ist.
Der zweite Einwand gegen ihre Theorie, den die Idealisten selbst liefern, ist mehr praktischer Art; denn fürs praktische Leben kann man recht wenig mit dem Idealismus, seinem Glauben an ein Allbewußtsein, neben dem die konkrete Wirklichkeit keine eigene Existenz habe, anfangen. Die idealistischen Denker können ihre Weltanschauung höchstens durchhalten, solange sie auf ihrem Katheder stehen; sobald sie in den Alltag hinabsteigen, müssen sie diese Weltanschauung beiseite setzen. Denn wenn sie essen und trinken, wenn sie eine körperliche Krankheit kurieren, wenn sie sich mit einem Gegner auseinandersetzen, so verhalten sie sich durchaus so, als ob Speise und Trank, der Leib und seine Gebrechen, der Gegner und seine Argumente nicht bloß Vorstellungen des Weltbewußtseins, sondern „gemeine“ Wirklichkeit wären, genau so, wie das der „gemeine Mann“ oder realistische Philosophen annehmen. Gewiß haben die Idealisten zumeist versucht, auch das Bewußtsein der Einzelmenschen und die Sinneserkenntnis in ihre Systeme einzugliedern. Sie mußten das schon, um die Tatsache des Irrtums bei den Menschen zu erklären. Denn das einheitliche Allbewußtsein, das die ganze Welt in sich beschließen soll, muß allwissend sein, und so wird es von jenen Philosophen gedacht, die es mit der Gottheit gleichsetzen. Das individuelle Bewußtsein des Menschen jedoch ist, auch wenn es ein Teil des Allbewußtseins ist, nicht nur beschränkt, indem es vieles überhaupt nicht weiß, sondern auch irrend, indem das, was es zu wissen glaubt, sich oft als irrig erweist.
Gerade das Problem der „Individuation“, der Absonderung des individuellen Bewußtseins vom kosmischen Bewußtsein, ist eine der größten Schwierigkeiten der idealistischen Philosophie. Die meisten Denker haben dafür überhaupt keine plausible Erklärung. Einer der wenigen, die das Problem ernsthaft behandelt haben, ist Leibniz, nach dem die individuelle Seele, die Monade, ein Mikrokosmos ist, der zwar grundsätzlich die gesamte Welt „vorstellt“, aber nur in unklarer Weise, während allein die Gottheit, die Monas monadum, die Gesamtwelt in vollendeter Klarheit denken soll.
[087]
Zumeist wird die Begrenztheit des Bewußtseins im Individuum durch seine Gebundenheit an einen Leib erklärt, in dem die Seele nach Plato wie in einem Gefängnis wohne. Auch die christlichen Philosophen erklären nicht nur die Irrtümer, sondern auch die moralische Sündhaftigkeit der gottähnlichen Seele durch ihre Gebundenheit an den Leib. Und ebenso wird bei Descartes, bei Spinoza und anderen die Beschränkung der individualisierten Vernunft durch die Gebundenheit an den Leib erklärt, dem auch die Sinneserkenntnis zugerechnet wird. Dabei entsteht jedoch die logische Inkonsequenz, daß der Leib, der wie alle Materie nur Inhalt des Bewußtseins sein soll, jetzt als Wirklichkeit genommen wird. Daß der Leib wie alle Materie nur eine unklare „Vorstellung“ sei, wie das Leibniz lehrt, ist eine wenig befriedigende Erklärung.
Dazu kommt, daß die von den Idealisten so gering geschätzte Sinneserkenntnis doch nicht bloß Irrtum ist, sondern sich weithin recht gut bewährt, ja, eine unentbehrliche Voraussetzung für die Existenz der Individuen ist. Und Kant, vorsichtiger als die radikalen Idealisten, hat den Sinnesempfindungen daher auch einen gewissen Erkenntniswert zugebilligt, obwohl sie erst durch die Verarbeitung durch die Formen des reinen, des apriorischen Denkens volle Erkenntnis werden sollen.
Überhaupt wird man gerade Kant, obgleich manche seiner Anhänger ihn zum Vertreter eines extremen Idealismus machen wollen, gewichtige Argumente gegen diese Philosophie entnehmen können. Denn er gibt dem allgemeinen Bewußtsein nur eine „logische“, nicht eine metaphysische Existenz. Er beweist ferner, daß die Vernunft allein keine sichere Erkenntnis zu erbringen vermag, und daß die vermeintlich rein rationale Erkenntnis höchstens „Ideen“ liefert. Soll die Bewußtseinstheorie der Idealisten irgendwie auf die Praxis des Lebens angewandt werden, so kommt sie nicht um die Tatsache des Bewußtseins des Einzelmenschen herum, von dem wir jedenfalls etwas mehr wissen als vom Allbewußtsein. Ich werde daher, um die Bedeutung des Bewußtseins in der Welt zu ergründen, vom Bewußtsein der Individuen ausgehen, was nicht besagt, daß damit die Problematik erschöpft wäre.
Denn, obwohl ich im Ausgangspunkt wie in den Folgerungen in vielem vom Idealismus abweiche, so komme ich, vom Bewußtsein der Individuen ausgehend, doch zu Ergebnissen, die sich dem Idealismus annähern. Denn der Idealismus hat durchaus richtig gesehen, daß das Bewußtsein der Individuen keineswegs bloß individuelles Bewußtsein ist, sondern daß viel Überindividuelles darin mitwirkt. Er hat auch durchaus recht, daß wir im Bewußtsein die Objekte nicht in voller Realität ergreifen, sondern nur in ihrer „Erscheinung“, in „Über-setzung“, wie ich sage. Und drittens hat er recht, daß das Bewußtsein ein kosmisches Phänomen ist, wenn man auch nicht von einem kosmischen Bewußtsein im Sinne eines ins Kosmische ausgeweiteten menschlichen Bewußtseins reden darf, wenigstens nicht als einer sicheren Erkenntnis, aber immerhin, wie ich das tue, als einem Problem, das vom Bewußtsein des Menschen aus zwar gestellt werden muß, aber vielleicht nie ganz zu beantworten ist.
[088]
Das Bewußtsein der Individuen als Ausgangspunkt
Im Gegensatz zu den idealistischen Philosophen hat der „gemeine Mann“ zu allen Zeiten wenig über ein Allbewußtsein gegrübelt, sondern hat das Bewußtsein der Individuen und die darin sich erschließende Außenwelt unbedenklich als Wirklichkeit genommen. Die „Individuation“ ist ihm überhaupt kein Problem, sondern eine Erfahrungstatsache. Dazu gehört auch die Einsicht, daß das Bewußtsein, das jeder in sich erlebt, gebunden ist an einen individuellen Leib, den jeder mitdenkt, der „ich“ sagt. Es ist eine Urerkenntnis in allem Bewußtsein, daß bei jedem Bewußtseinsakt nicht bloß das Bewußtsein, sondern das zugleich körperliche „Ich“ beteiligt ist. Denn die Sprache sagt mit Recht nicht etwa: „das Bewußtsein sieht, hört, denkt“, sondern: „Ich sehe, höre, denke“, wobei man sich klar ist, daß auch der Leib dabei mitwirkt. Schon das kleine Kind merkt ja, daß es, um zu sehen, seine Augen braucht, und daß das Sehen aufhört, wenn es die Augenlider schließt. Der berühmte Satz des Descartes, der für ihn Ausgangspunkt aller Philosophie sein soll, hat – einerlei wie ihn Descartes gemeint hat – nur seinen vollen Sinn, wenn wir in der deutschen Ubersetzung betonen: „Ich denke, also bin ich“, wobei man nicht an ein abstraktes Ich, sondern an das Ich als leiblichseelische Einheit zu denken hat. Zugleich aber schließt dies Denken die Einsicht ein, daß das Sein dieses Ich zwar nicht erkenntnistheoretisch, aber genetisch dem Denken vorausgeht; jener Satz sagt nicht, wie er von manchen Idealisten gedeutet wird, daß das Denken das Ich erschafft, sondern daß es das Ich vorfindet. Diese Tatsache, daß das leiblich-seelische Ich lange besteht, ehe es zu denken und gar einen so abstrakten Gedanken wie „cogito ergo sum“ zu denken vermag, ist an jedem menschlichen Individuum in seiner Entwicklung festzustellen; ja, es ist sogar eine bekannte Tatsache, daß das Kind sehr viel anderes gedacht und wahrgenommen hat, ehe es „ich“ sagen und denken lernt; denn wohl alle Kinder sprechen von ihrem Ich zunächst in der dritten Person.
Der Erkenntnis, daß alles Bewußtsein an ein geistig-leibliches Ich gebunden ist, geht ferner das Wissen parallel, daß das Bewußtsein einer außerbewußten Realität gegenübersteht, die bewußt wird. Älter als der Gedanke „ich denke“, der schon eine Abstraktion von dem stets vorhandenen Objekt voraussetzt, ist daher der Gedanke „ich denke etwas“, oder wie Driesch, der diesen Satz zur Basis einer Erkenntnislehre macht, es ausdrückt: „Ich habe bewußt etwas.“ Der Nachdruck hat dabei auf dem Etwas zu liegen. Ganz sicherlich bemerkt jedes Kind viele Dinge, ehe es sich bewußt wird, daß sein Ich sie bemerkt. Und bei den Tieren können wir zwar mit Sicherheit sagen, daß sie Gegenstände bemerken, aber niemand wird glauben, daß ein Tier sich bewußt wird, daß sein „Ich“ diese Gegenstände bemerkt.
Dafür schließt das Bewußtsein des Menschen (wie auch wohl das der Tiere) stets noch ein weiteres Wissen ein, daß es die Gegenstände nicht bloß im Bewußtsein erlebt, sondern auch körperlich mit ihnen in [089] Beziehung treten kann. Das Kind greift instinkthaft nach allem, was es sieht, und sucht etwas damit zu „machen“, und gerade im Wirken erlebt es Dinge als „Wirklichkeit“; d. h. auf Grund körperlicher Akte erlebt es die Dinge als „körperlich“. Wir werden später sehen, daß auch die Tiere nur das bemerken, worauf ihre Instinkte, d. h. körperliche Tätigkeitsanlagen, ausgerichtet sind und worauf sie körperlich reagieren. Dadurch aber wird das Handeln zu einer selbständigen Erkenntnisquelle. Und kein Kind und kein Erwachsener begnügt sich mit bloßem Anschauen oder Denken der Objekte, sondern jeder will wissen, was er damit „machen“ kann. Erst wenn er das ausprobiert hat, meint er, daß er das Objekt „kenne“. Das Bewußtsein ist kaum je „reines“ Bewußtsein, sondern stets in ein zugleich körperlich-praktisches Verhalten, wozu auch das Sprechen gehört, eingegliedert.
Drei Grundeinsichten schwingen also in allem spezielleren Bewußtseinserleben mit und sind die Voraussetzungen alles menschlichen Bewußtseins; erstens, daß alles Bewußtsein zunächst das Bewußtsein eines seelisch-leiblichen Ich ist; zweitens, daß im Bewußtsein eine Beziehung besteht zu einer außerbewußten Wirklichkeit; und drittens, daß außer dem Bewußtsein auch ein körperliches Inbeziehungtreten zu dieser Wirklichkeit im Handeln, im „Wirken“, möglich ist.
Die hier gekennzeichneten Voraussetzungen des gesunden Menschenverstandes werden nicht nur von jedem „gemeinen Manne“ stillschweigend gemacht, sie sind auch Voraussetzungen aller Wissenschaft, die nicht herrisch beiseite geschoben, sondern anerkannt, wenn auch modifiziert werden müssen. Und jede Philosophie, die nicht Religion oder Dichtung, sondern Wissenschaft sein will, wird sie anerkennen müssen, was jedoch nicht heißt, daß sie dabei stehenbleiben soll. Wir nehmen das Bewußtsein der Individuen als Ausgangspunkt, aber nur als Ausgangspunkt. Wir glauben nicht, daß sich im Alltagsdenken die Wirklichkeit voll erschließe, vielmehr sind wir auch darin mit den Wissenschaften einig, daß das Wesen aller Weltgebiete erst zu erforschen ist und so auch das Wesen des Bewußtseins. Es scheint mir daher unumgänglich für jede Theorie des Bewußtseins, daß sie nicht bloß nach vermeintlich angeborenen Wahrheiten grübelt, sondern das, was sich in der neueren Einzel Forschung zu diesem Problem ergeben hat, möglichst eingehend berücksichtigt.
Das Bewußtsein in der modernen Psychologie
Unter den Spezialwissenschaften, die sich mit dem Bewußtsemsproblem befassen, stelle ich die Psychologie voran, die es als Hauptaufgabe ansieht, das sogenannte Bewußtsein zu analysieren, zu ordnen und in seinem Zusammenhang verständlich zu machen. Schon die Tatsache, daß man eine solche Psychologie für nötig hält, verrät, daß das unmittelbare Bewußtsein über sich selbst recht wenig weiß. Im übrigen steht die Psychologie insofern ganz auf dem Boden des Realismus, als sie die Existenz der Außenwelt gar nicht anzweifelt, [090] sondern annimmt, daß die von dieser ausgehenden „Reize“ dem Bewußtsein, das wesentlich als individuelles Bewußtsein gefaßt wird, erst seinen hauptsächlichen „Inhalt“ geben.
Über das Bewußtsein hinausgehend hat die Psychologie, speziell als Physiopsychologie, vor allem das Verhältnis des Bewußtseins zum Leibe untersucht und dabei einige Tatsachen ermittelt, die dem gesunden Menschenverstand, aber auch der älteren Philosophie nicht bekannt waren. Ganz allgemein ist da zunächst bestätigt, daß es Bewußtsein nur in Verbindung mit einem Leibe gibt. Körperlose Geister, Gespenster, sind ins Gebiet des Aberglaubens verwiesen. Und zwar sind nicht etwa bloß die Empfindungen der Sinne an körperliche Organe gebunden, auch das Gedächtnis, die Phantasie, das abstrakte Denken sind mit Sicherheit dem Gehirn (das Aristoteles noch für einen Kühlapparat für das Blut hielt) zugewiesen, mag auch die Lokalisation an bestimmte Hirnpartien strittig sein. Aber es ist nicht zu bezweifeln, daß Verlegungen gewisser Hirnpartien auch Ausfälle des Gedächtnisses und bestimmter Denkfunktionen nach sich ziehen, die sich allerdings in bisher ungeklärter Weise zuweilen restituieren, d. h. von anderen Partien übernommen werden, also daß das Gehirn doch zugleich als „Ganzheit“ arbeitet.
Darüber hinaus ist erwiesen, daß für alle Bewußtseinsvorgänge nicht bloß Hirnprozesse, sondern auch Bewegungen des übrigen Körpers von entscheidender Bedeutung sind. Das Sehen bestimmter Gegenstände ist nur möglich auf Grund von Bewegungen des Auges, wodurch wir das Bewußtsein fixieren und im Raum lokalisieren. Ebenso sind beim Hören, Riechen und allen anderen Sinneswahrnehmungen Adaptionsbewegungen der Organe notwendig, die die Empfindung erst zur objektbezogenen Wahrnehmung machen. Auch das Denken geht nicht ohne Bewegungen vor sich; denn es ist, auch als „stilles“ Denken, an Sprechbewegungen gebunden, wodurch es erst Gestalt gewinnt. Ja sogar Gefühle und Affekte sind von körperlichen Bewegungen nicht zu trennen, besonders von Bewegungen des Herzens und der Eingeweide, was das Volk sehr wohl weiß, da es als Sitz der Gefühle das Herz bezeichnet. Unzweifelhaft sind alle „Gemütsbewegungen“ zugleich Bewegungen innerer Organe, zu denen auch die neuentdeckten inneren Drüsen zählen. Mag auch im einzelnen der Zusammenhang dieser körperlichen Vorgänge mit dem Bewußtsein nicht völlig aufgehellt sein, daß ein Zusammenhang besteht, ist heute nicht abzustreiten. Wie sehr körperliche Tätigkeiten auch für die Erkenntnis der Außenwelt notwendig sind, wird später zu erörtern sein. Aber schon jetzt ist zu sagen, daß alles Gerede von einem „reinen“, ohne Kontakt mit dem Leibe sich betätigenden Bewußtsein durch die Physiopsychologie als widerlegt gelten kann.
Was nun die Bewußtseinsvorgänge als solche anlangt, so glaubt heute kein Psychologe mehr an „angeborene rationale Ideen“, sondern man nimmt an, daß der „Inhalt“ des Gegenstandsbewußtseins hauptsächlich durch Empfindungen geliefert werde. Allerdings ist der reine Sensualismus, der nur Empfindungen und deren Reproduktionen, die „Vorstellungen“, gelten ließ, heute verlassen. Man weiß, welche Rolle [091] Gefühle und Willensantriebe in der Seele spielen, die das von den Sinnen gelieferte Material mannigfach modifizieren und umgestalten. Dadurch ist bestätigt, was wir eingangs sagten, daß das sogenannte Bewußtsein nicht bloß ein Wissendsein, sondern auch ein Wertendsein ist, und daß diese Wertung keineswegs bloß eine Wahrheitswertung, das heißt auf „Übereinstimmung“ des Bewußtseins mit der Außenwelt gerichtet ist, sondern daß daneben auch andere Wertungen mitspielen, die oft der „Wahrheit“ ganz entgegengerichtet sind. Schon die „Aufmerksamkeit“, daß wir aus der Fülle der stets auf uns einwirkenden Reize nur wenige, aber diese verstärkend herausheben, ist eine Wertung. Sie ist zumeist durch Gefühle akzentuiert, ist aber auch mit Tätigkeitseinstellungen verknüpft. Wir beachten in der Umgebung vor allem das, was mit unserer Tätigkeit zusammenhängt. Auch das Gedächtnis schleppt nicht wahllos alles mit, was an Eindrücken auf das Ich einströmt, sondern trifft eine Auswahl unter ihnen; ein „gutes“ Gedächtnis ist nicht eins, das wahllos viel, sondern das für die jeweilige Tätigkeitseinstellung des Ich Notwendige behält und dies stets zur Verfügung stellt, wenn es gebraucht wird. Ebenso ist das abstrakte Denken nicht von Willenseinstellungen zu trennen; welches Problem aufgegriffen wird, ebenso seine Festhaltung und Bearbeitung, ist sehr wesentlich Willens- und Wertungssache. Alles das ist in der älteren Logik und Erkenntnistheorie nicht genügend beachtet worden.
Wohl der bemerkenswerteste Beitrag der neueren Psychologie zur Philosophie des Bewußtseins ist aber der, daß das, was man gemeinhin als „Bewußtsein“ anspricht, gar nicht völlig bewußt ist, sondern durchwirkt von unbewußten, aber darum keineswegs bloß leiblichmateriellen Faktoren. Zwar die Psychologie um 1900 rühmte sich, „Psychologie ohne Seele“ zu sein, d. h. ohne „Seele“ im Sinne eines an sich unbewußten Trägers des Bewußtseins. Sie setzte „Seele“ mit „Bewußtsein“ gleich, d. h. sie bezeichnete als ihr Forschungsgebiet nur die Beschreibung und Verknüpfung der Bewußtseinstatsachen. Dieser Standpunkt ist heute nicht mehr haltbar; vielmehr hat sich das Interesse im zwanzigsten Jahrhundert immer mehr auf die in allem Bewußtsein mitwirkenden unbewußten, richtiger unterbewußten Tatsachen konzentriert. Man weiß zunächst, daß in alles Bewußtsein Faktoren eingehen, die als solche nicht bewußt sind. Die schon erwähnten Bewegungsempfindungen des Auges, wodurch wir die Gegenstände lokalisieren, sind an sich nicht bewußt; sie gehen jedoch mit den rein visuellen Empfindungen in die Ganzheit der Wahrnehmung ein. Ebenso sind in der „Aufmerksamkeit“ die sie bedingenden Gefühle und Tätigkeitseinstellungen nicht als solche bewußt, sie bilden aber ein Plus, das zu der objektiven Reizwirkung hinzukommt. Ferner sind alle Erinnerungen, die uns einen Gegenstand als „bekannt“ erscheinen lassen und auf Grund deren wir ihn begrifflich einordnen, nicht distinkt bewußt; sie gehen jedoch als wichtige Teilfaktoren ins Bewußtsein ein. Besonders jene Erinnerungen und Gefühle, die als unbewußte Komplexe das Bewußtsein beeinflussen, sind von der Psychoanalyse erforscht worden.
[092]
Neuerdings beachtet die Psychologie nicht bloß die früher allein studierten „Inhalte“ des Bewußtseins, sondern auch die hinter ihnen wirksamen „Akte“, Dispositionen, Anlagen, kurz, sie nimmt eine hochkomplizierte „Struktur“ an, die zum Teil gewiß leiblich ist, zum Teil aber auch als unbewußt seelisch angesprochen werden muß. Insonderheit die „Charakterologie“ ist nicht mehr bloß Wissenschaft vom Bewußtsein, sondern, indem sie die Charaktere unterscheidend vergleicht, legt sie nicht ein überall gleiches Schema von Anlagen dem Bewußtsein der Individuen zugrunde, sondern sie nimmt sehr große Verschiedenheiten der Struktur an, was durch die spezielleren Disziplinen der Psychologie der Kinder, der Geschlechter, der sozialen Gruppen und der Kultur bestätigt wird. „Bewußt“ sind diese Anlagen nur zum geringen Teil, aber sie sind als notwendig zu erschließende Voraussetzungen des Bewußtseins anzusehen, und der lange verworfene Begriff der „Seele“ stellt sich wieder ein.
Die Forschungen der Psychologie widerlegen also in verschiedener Richtung die idealistische Lehre von der Unkörperlichkeit des Bewußtseins. Sie bestätigen, daß alles Bewußtsein an einen Leib gebunden ist, der nicht bloß ein Gefängnis der Seele und nicht ein zufälliger „Träger“ des Bewußtseins ist, sondern ein wunderbar feines Instrument des Bewußtseins und zugleich als Körper der Vermittler zwischen dem Bewußtsein und der körperlichen Wirklichkeit, die wir zunächst durch den Körper physiologisch erleben, ehe uns das bewußt wird. Damit ist jedoch nicht einem groben Materialismus recht gegeben, vielmehr zeigen die Forschungen der auch die unbewußte „Struktur“ des Bewußtseins berücksichtigenden Psychologie, daß diese Struktur zwar an den Leib gebunden, aber nicht mit ihm identisch und weit komplizierter ist, als sowohl der Materialismus wie der Idealismus annahmen, der mit einem angeblich überall gleichen schematischen „Apriori“ des Bewußtseins arbeitete. Wohl bestehen im Menschen gewisse, aller Erfahrung voraufgehende und sie ermöglichende Anlagen, aber diese sind in ihrer individuellen Ausbildung, die weithin durch kulturelle Einflüsse bedingt ist, viel mannigfaltiger, als die schematisierende Erkenntnistheorie des Idealismus angenommen hatte; und sie sind auch nicht bloß auf „Wissen“ gerichtet, sondern auf höchst mannigfaches Wirken, aus dem nachweisbar sehr allmählich die gesamte Kultur und auch die Wissenschaft erwachsen sind.
Die Physik und das Bewußtsein
Zwar nicht für die Erkenntnis des Bewußtseins selbst, aber für dessen Verhältnis zur Außenwelt, grundlegend, ja revolutionierend sind auch die Ergebnisse der Physik. Was diese Forschung besonders in den letzten Jahrzehnten an Entdeckungen erbracht hat, wirft nicht bloß viele Dogmen der Idealisten, sondern auch die Erfahrungserkenntnis des „gemeinen Mannes“, des „naiven Realisten“ über den Haufen. Es widerlegt nicht nur die These von der reinen Subjektivität der Wirklichkeit, sondern auch die vermeintliche Objektivität derer, die da [093] glauben, sie nähmen mit ihrem „gesunden Menschenverstand“ die Dinge und die Welt so wahr, wie sie „in Wirklichkeit“ seien.
Die glänzenden Ergebnisse der neueren Physik sind weder aus einer angeborenen reinen Vernunft noch auf Grund der natürlichen Sinneserlebnisse gewonnen, sondern auf eine praktische, indirekte Weise, wobei das Bewußtsein nur die Aufgabe des „Registrierens“ hat, während das Material der Erkenntnis aus ganz anderen Quellen bezogen wird. Diese „indirekte Methode“ beruht darauf, daß man nicht bloß die direkten Einwirkungen der Dinge auf die Sinne und den Verstand beobachtet, sondern daß man die Dinge aufeinander wirken läßt und sie dadurch zwingt, Seiten ihres Wesens zu offenbaren, die das „reine“ Bewußtsein nie kennenlernen würde. Vor allem in der Methode des Experiments ist systematisch diese indirekte Quelle der Erkenntnis erschlossen. Wüßten wir zum Beispiel vom Schwefel nur, was uns die Sinne über ihn sagen, daß er gelb, spröde, geschmack- und geruchlos ist, so wüßten wir sehr wenig. Indem wir ihn aber erhitzen und mit anderen Stoffen zusammenbringen, offenbart der Schwefel Eigenheiten, von denen die reinen Sinne oder die reine Vernunft nie etwas erfahren hätten. Die Sinne stellen dabei nur fest, was das praktische Behandeln der Dinge auf indirektem Wege ihnen abzwingt, was dann aber Gegenstand mathematischer Formulierung und Berechnung wird.
Zunächst sind in der Physik die natürlichen Erkenntnisquellen durch weit exaktere Erkenntnismöglichkeiten ersetzt. Die Wärme eines Gegenstandes, sein Gewicht und seine Härtegrade werden durch künstliche Apparate weit genauer festgestellt als durch die Hautsinne; mit Hilfe des Photometers wird die Lichtstärke weit genauer festgestellt als durchs Auge allein, alle anderen Sinne werden in ähnlicher Weise durch exaktere Instrumente ersetzt. Die Ärzte des Mittelalters mußten um den Zuckergehalt des Urins festzustellen, eine Probe davon auf die Zunge bringen; heute hat man Methoden, die nicht nur in weniger unappetitlicher Weise, sondern auch viel genauer den Zuckergehalt bestimmen. Alles das aber ergibt, daß unser natürliches Bewußtsein von der Welt den wahren Tatbestand nicht nur höchst ungenau, son-rdern vielfach geradezu falsch erfaßt. Zugleich aber wird die Behauptung, es entspräche unserem Bewußtsein überhaupt keine Wirklichkeit, geradezu lächerlich, da wir durch die indirekte Methode mit Sicherheit tausenderlei Tatsachen über die Substanz und die Struktur der Dinge feststellen können, von denen weder der naive Realismus noch die ältere Philosophie etwas ahnte, wenn sie etwa mit Berkeley und Hume Esse gleich Percipi, also „Sein“ und „Wahrgenommenwerden“ als identisch ansah.
Was da die Physik über die eigentliche Natur der uns vermeintlich genau bekannten Dinge ermittelt hat, ist phantastischer als jedes Märchen aus „Tausendundeine Nacht“ und doch das Ergebnis sehr exakter Experimente und Berechnungen. Der Tisch zum Beispiel, an dem ich schreibe, ist gar nicht das feste, kompakte „Ding“, als das er allen naiven Realisten erscheint, sondern er besteht nach der Physik aus [094] Elektrizität, also einem „Stoffe“, den man ungeheuer vergröbern würde, wollte man ihn als „luftig“ bezeichnen. Der Tisch ist sogar überwiegend hohl und aufgebaut aus winzigen Korpuskeln, den Protonen, um die mit rasender Geschwindigkeit als Planeten oder, richtiger, als Wellen die noch viel kleineren Elektronen kreisen, die die Protonen zu Atomen ergänzen. Was unserer zupackenden Hand als „Festigkeit“ erscheint, ist nur der Widerstand, den die Multillionen dieser Atome der Hand entgegensetzen. Das, was wir die Wahrnehmung oder den Begriff vom Tische nennen, ist also nicht eine exakte Kopie der Wirklichkeit, sondern eine Übertragung in ein ganz anderes Material, die mit der Wirklichkeit noch weniger „Ähnlichkeit“ hat als der gedruckte Klavierauszug einer Symphonie mit der klingenden Tonflut, die das Orchester entfesselt.
Aber die Dinge sind überhaupt nicht bloß „da“, wo die zugreifende Hand sie feststellt. Ihr „Dasein“ reicht weit über die Grenze des Greifbaren hinaus; sie überschreiten überall diese „Grenze“. Sie sind – wenigstens bei Belichtung – stets umgeben von einer Aura von Strahlen, die sie allenthalben reflektieren und womit sie ihr „Bild“ überallhin projizieren, also daß man die Dinge überall sehen kann, wohin die Strahlen dringen. Der gesamte Raum ist nicht „leer“, sondern erfüllt von den durch die Strahlen in ihn projizierten „Bildern“ der Dinge, aus denen das Auge und damit das Bewußtsein nur die heraushebt, die die Pupillen einlassen. Ebenso senden die Dinge Wärmestrahlen aus, die wir nicht sehen, aber unter Umständen, so wenn wir uns einem heißen Ofen nähern, mit den Temperaturnerven wahrnehmen. Die Dinge schicken aber auch Kunde von ihrer chemischen Beschaffenheit in den Raum hinaus; sie entlassen über ihre „Grenze“ beständig Moleküle, die wir als „Geruch“ wahrnehmen, obwohl menschliche Nasen keine sehr feinen Apparate sind und viele Tiere Gerüche erleben, von denen wir nichts ahnen. Denn alle Dinge, auch die für uns „geruchlosen“, entsenden ihre „Gerüche“, das heißt Moleküle ihrer Substanz, die Gerüche bewirken, wenn sie auf ein adäquates Organ treffen. Eine schwingende Glocke teilt der sie umgebenden Luft ihre Schwingungen mit, und diese „Mitteilung“ wird zum Klang, sobald sie unser Trommelfell trifft, auch dann, wenn die Glocke sehr weit entfernt ist. Die Wirklichkeit der Dinge ist also mit ihrem „Dasein“ nicht identisch, sondern sie wirkt weit hinaus in ihre Umgebung, also daß eine Grenze gar nicht anzugeben ist; denn mit dem Fernrohr sehen wir vieles auch an solchen Orten, wo wir mit dem unbewaffneten Auge nichts mehr von seinem Dasein wahrnehmen.
Es ist also nicht richtig, wenn ältere Philosophen die Färb- und Geruchswirkung als „sekundäre“ Eigenschaften bezeichneten und sie für bloß subjektiv hielten. Auch die sekundären Eigenschaften sind im Objekt begründet, aber sie sind zugleich subjektiv, indem die ihnen zugrunde liegende Wirklichkeit in bewußte Empfindungen transponiert wird. Sowohl der Idealist, der das Grün des Baumes, den er sieht, für nur subjektiv hält, irrt, als auch der naive Realist, der das [095] Grün für eine objektive Eigenschaft des Baumes hält. Unsere wissenden Erlebnisse sind nicht bloß subjektiv, und die uns bewußtwerdenden Dinge sind nicht bloß objektiv, sondern „Bewußtsein“ wie „Dinge“ sind stets zugleich subjektiv und objektiv; wir erleben nicht: „hie Bewußtsein – dort Welt“, sondern wir leben in einer Bewußtseinswelt. Es ist kein Ruhmesblatt der Philosophie, daß die Berkeley und Hume, die die Existenz der Dinge mit ihrem Wahrgenommenwerden gleichsetzten, dabei nicht Rücksicht auf die damals die Welt erregenden Forschungen Newtons und anderer Physiker über das Wesen des Lichts nahmen, und daß sie auch nicht durch die mikroskopischer[n] Beobachtungen Leeuwenhocks und anderer daran irre wurden, daß das, was wir wahrnehmen, auf keinen Fall die ganze Wirklichkeit ist.
Die Zwischenglieder zwischen Subjekt und Objekt
Aus den hier skizzierten Ergebnissen der Psychologie und der Physik hat auch die heutige Philosophie nicht alle Erkenntnisse gezogen, die damit angebahnt sind. Beim Versuch, jene so weit auseinanderliegenden Ergebnisse zu einheitlicher Bewußtseins- und Erkenntnistheorie zu vereinheitlichen, halten auch neuere Denker durchaus an alten, aber hinfällig gewordenen Anschauungen fest, als ob wir die Welt unmittelbar im Bewußtsein erfaßten.
Auch der Vorgang des Bewußtwerdens von Objekten ist weit komplizierter, als es in der herkömmlichen Erkenntnislehre erscheint, die nur Subjekt und Objekt, „Bewußtsein“ und „Dinge“ einander gegenüberstellt und nun vergeblich fragt: wie kann das Bewußtsein von den von ihm oft durch große Zwischenräume getrennten „Dingen“ Erkenntnis gewinnen? Auf Grund der heutigen Psychologie und Physik stellt sich der Tatbestand zunächst nicht als zwei gliedriges, sondern als vier gliedriges Geschehen dar. Sehe ich zum Beispiel den Baum vor meinem Fenster, so ist dabei erstens Voraussetzung das Dasein des Baumes, also des Objekts. Es ist zweitens Voraussetzung, daß der Baum hochkomplizierte Strahlen reflektiert, die in mein Auge gelangen. Es ist drittens Voraussetzung, daß in meiner körperlichen Organisation die physikalischen Strahlenwirkungen in sehr subtile physiologische Prozesse umgewandelt werden, die, im Auge beginnend, über die Nerven ins Gehirn gelangen. Und es ist viertens Voraussetzung, daß sie im Hirn die bewußte „Wahrnehmung“ wirken. Das Bewußtsein selbst „überspringt“ dabei die Zwischenglieder der Strahlenwirkung und den physiologischen Prozeß und ordnet die Wahrnehmung unmittelbar dem Objekt selbst zu. Das ist gewiß sehr wichtig; denn nur dadurch entsteht der scheinbar unmittelbare Kontakt zwischen Bewußtsein und materiellem Gegenstand; es ist jedoch unverzeihlich, wenn eine Erkenntnistheorie glaubt, diese Zwischenglieder unbeachtet lassen zu dürfen. Erst dadurch wird das Gesamtphänomen unverständlich, während durch Einbeziehung der Zwischenglieder ein geschlossener Kausalzusammenhang hervortritt, der zwar in den [096] Einzelheiten noch Probleme genug bietet, aber in seinen Hauptzügen völlig klarliegt.
Der viergliedrige Wahrnehmungsprozeß ist aber zugleich eine mehrfache Übersetzung völlig verschiedener Tatbestände ineinander. Zunächst überträgt sich die besondere Beschaffenheit des Objekts in die Strahlen, indem es nicht alle es treffenden Lichtstrahlen zurückwirft, sondern nur die, die es je nach seiner Beschaffenheit nicht verschluckt. Auf diese Weise teilt sich die „Farbe“ und durch diese auch die Gestalt des Objekts den Strahlen mit, und beides wird rings in den Raum, hinausprojiziert. So gelangen sie ins Auge, wo sie in der Netzhaut in physiologische Prozesse „übersetzt“ werden, über deren Wesen wir zwar, ebenso wie über ihre Weiterwirkung in den Nerven und den Hirnganglien, im einzelnen wenig wissen, die aber zweifellos Tatsachen sind und jedenfalls etwas ganz anderes als die physikalischen Reize. Und im Hirn werden jene physiologischen Prozesse abermals in etwas völlig anderes „übersetzt“, nämlich in Bewußtseinserlebnisse, die wiederum von allen früheren Vorgängen ganz verschieden sind.
Soweit ist der Zusammenhang klar. Schwierigkeiten macht jedoch die Frage, wie es möglich ist, daß das durch mehrfache Übersetzungen gelaufene subjektive Bewußtsein dem bewußtwerdenden Objekt zugeordnet werden kann, also daß wir die flüchtigen immateriellen Bewußtseinserlebnisse, zum Beispiel die Grünempfindung, dem Baume als dessen dauernde Eigenschaft zuschreiben, und daß wir sie nicht in Auge oder Hirn, sondern am Baume zu erleben glauben. Negative Voraussetzung dafür ist, daß das Be„wußt“-Sein gar nichts weiß von Strahlen und physiologischen Prozessen, die völlig unbewußt im Erleben bleiben und „übersprungen“ werden. Positive Voraussetzung aber ist die „Lokalisierung“ des Bewußtseins im Raume an der Stelle, wo sich das Objekt befindet.
Hier nun greifen noch weitere Teilakte des gesamten Wahrnehmungsprozesses ein, die ebenfalls nicht gesondert ins Bewußtsein dringen, sondern von diesem „übersprungen“ werden, die aber ebenfalls von der Erkenntnistheorie sehr zu Unrecht nicht beachtet werden, obwohl sie objektiv nachweisbar sind. Die obengeschilderte viergliedrige Ubersetzung ist noch nicht der ganze Wahrnehmungsprozeß, sondern nur ein Teil. Daß Ich nämlich verhält sich den Reizen gegenüber nicht völlig passiv, sondern sehr aktiv. Vor allem lösen die Reize, sobald sie ins Hirn treten, Adaptationsbewegungen aus, zunächst der Augenmuskulatur, oft aber auch des Kopfes, ja, des gesamten Leibes, indem sich das Ich so einstellt, daß es den Eindruck möglichst direkt und klar empfängt. Durch diese Adaptationsbewegungen aber wird zugleich die Richtung, aus der das Objekt die Strahlen aussendet, erkannt, und die dabei auftretenden Bewegungsempfindungen gehen, als an sich nicht bewußte Teilfaktoren, in das Gesamterlebnis ein. Sie geben jedoch nicht bloß von der Richtung, sondern, vor allem durch die Kombination der Bewegungen beider Augen, auch von der Entfernung des Objekts Kunde. Vielfach aber treten, wenn die Augenbewegungen aus irgendeinem Grunde uns nicht sicher genug sind, [097] noch weitere Bewegungsakte als Helfer hinzu, indem wir nach dem Gegenstand greifen oder zu ihm hingehen, wodurch wir den „Sehraum“ mit dem „Greif- und Gehraum“ zur Einheit bringen. Bekanntlich können operierte Blindgeborene nicht sofort ihre Sehempfindungen mit dem ihnen vorher bekannten Greif- und Gehraum in Einklang setzen, was sie erst durch wiederholte Erfahrungen lernen. Beim normalen Menschen aber gehen Erinnerungen an frühere Greif- und Gehbewegungen stets in die visuelle Raumschätzung über und ermöglichen die richtige Lokalisation, die nicht völlig „angeboren“ ist, sondern durch Übung sehr verfeinert werden kann, also daß zum Beispiel Jäger in Entfernungsschätzungen weit sicherer sind als andere Menschen.
Wenn also Kant den „Raum“ als „Form der Anschauung“ schildert, so ist das nicht erschöpfend: er ist mindestens ebensosehr ein Effekt der Körperbewegungen, die zur bloßen „Anschauung“ notwendig hinzutreten müssen. Auch ist das Raumerleben nicht „a priori“, sondern – wenn auch auf Grund der angeborenen physiopsychischen Organisation – wesentlich eine Erfahrungstatsache, was bei jedem Kinde zu beobachten ist; denn Kinder greifen zunächst auch nach unerreichbaren Dingen, sogar dem Monde, bis sie auf Grund von Erfahrungen lernen, den Gesichtseindruck richtig zu lokalisieren.
Indessen nicht nur für die Wahrnehmung der räumlichen Qualitäten der Objekte sind Bewegungen notwendig. Vieles, was wir den Gegenständen „anzusehen“ glauben, stammt nicht aus dem Sehen allein, sondern aus Greif- und Tastbewegungen, die wir früher ausgeführt haben. Wenn man dem Gegenstand anzusehen glaubt, ob er hart oder weich, ob er schwer oder leicht ist, so kommt dies Wissen allein aus früheren Bewegungs- und Berührungserlebnissen, die jedoch als unterbewußte Erinnerungen in den Seheindruck eingehen. Das Erkennen ist nicht ein passives Abspiegeln, sondern ein aktives Erobern der Welt, und es bedarf dazu auch vielfacher „Waffen“, Instrumente, Apparate, die ebenfalls „Mittel“ des Bewußtseins werden. Kurz, die Gegenüberstellung von Bewußtsein und bewußtwerdenden Objekten ist ganz unzureichend. Stets reden auch die Beleuchtung, die Beschaffenheit der Atmosphäre, die körperliche Organisation und die gesamte seelische, oft unbewußte Disposition mit. Der Zauber vieler künstlerischer Gemälde beruht darauf, daß sie nicht den Gegenstand rein „objektiv“, sondern in spezifischer Beleuchtung, in atmosphärischer Besonderheit, getaucht in seelische „Stimmungen“, darstellen. Es wird nicht bloß der materielle Gegenstand gemalt, sondern so wie er umwoben ist von der Atmosphäre, dem kosmischen Lichtozean und als Ausdruck seelischer Stimmungen, die der Künstler in ihn eingefühlt hat.
[098]
Die Übersetzung der Welt ins Bewußtsein
Indem ich die Wahrnehmung, also das Inbeziehungtreten des Ich mit den Objekten, als mehrgliedrigen, kontinuierlichen Prozeß und zugleich als mehrfache „Ubersetzung“ schildere, ist die Frage offengeblieben, inwiefern dabei jene „Übereinstimmung“ oder „Entsprechung“, die man zwischen den subjektiven Bewußtseinserlebnissen und den damit gemeinten Qualitäten der Objekte annimmt, bestehen bleiben kann, eine Frage, die in ihrem ganzen Umfang kaum erörtert worden ist.
Der Begriff der „Übersetzung“, den ich dabei auf den Urawandlungsprozeß anwende, ist entnommen von den „Übersetzungen“, die man aus einer Sprache in eine andere, etwa aus dem Deutschen ins Französische, vornimmt. In bildlichem Sinne spricht man auch in der Mechanik, zum Beispiel beim Fahrrad, von „Übersetzung“. Bei Sprachen besteht die „Übersetzung“ darin, daß der gleiche Sinn in völlig verschiedenem Wortmaterial ausgedrückt wird. Es handelt sich also um Festhaltung einer gewissen Gleichheit in ganz anderem Material und anderer Form. Im Falle der Wahrnehmung also wird ebenfalls die Frage bestehen, was gleich ist und was sich ändert.
Zunächst also „übersetzt“ ist in der optischen Wahrnehmung zumeist ein sich dem Zugriff als feste Substanz darstellender Gegenstand in elektromagnetische Strahlen, also in ganz anderes Material, das je nach der Beschaffenheit der sie reflektierenden Gegenstände unterschiedliche Gestalt erhält. Gemeinsam ist den Strahlen dabei mit dem Gegenstand nur eine räumliche und zeitliche Zuordnung bestimmter Strahlen zu bestimmten Substanzen. Soweit kann der Vorgang als einigermaßen aufgehellt gelten, obwohl die Atomphysik ihn noch weit komplizierter darstellt.
Völlig dunkel jedoch ist die „Übersetzung“ der physikalischen Reize in physiologische Prozesse. Zwar nimmt man an, daß auf der Netzhaut durch die vorher in der Linse konzentrierten Strahlen chemische Vorgänge ausgelöst werden, die sich dann in den Nerven in weitere chemische Prozesse umsehen und darin weitergeleitet werden, ähnlich etwa wie sich das Feuer in einer Zündschnur weiterleitet; aber über die Einzelheiten weiß man wenig, am wenigsten über die Vorgänge, die durch die Nervenleitung in den Hirnzellen bewirkt werden. Hier ist alles Hypothese, und es bleibt völlig ungeklärt, was bei dieser Übersetzung noch an Übereinstimmung mit den Strahlen oder gar dem „Ding“ bestehen soll. Gewiß, die zeitliche Folge mag erhalten bleiben, aber wie sich die räumliche Ordnung der Strahlen, die man auf der Netzhaut noch feststellen kann, bei der Weiterleitung in den Nerven und in den Vorgängen in den Ganglienzellen erhalten soll, darüber wissen wir gar nichts und können also auch nicht angeben, wie bei der Ubersetzung ins „Bewußtsein“ diese räumliche Ordnung sich übertragen soll, obwohl zweifellos im Bewußtsein die räumliche wie die zeitliche Ordnung erlebt wird.
Das, was wir als „Übersetzung“ physiologischer Prozesse in bewußte Erlebnisse schildern, wird seit langem als „physiopsychischer [099] Parallelismus“ bezeichnet, aber höchst unzulänglich, ja gerade falsch erklärt. Man behauptet damit nämlich, daß sich die physiologischen und seelischen Vorgänge verhielten wie zwei parallele Linien, womit zugleich jeder Kausalzusammenhang geleugnet werden soll. Aber kann wirklich von „Parallelismus“ gesprochen werden? Höchstens in zeitlicher Hinsicht, obwohl es sich auch dabei nicht um absolute Gleichzeitigkeit, sondern um eine, wenn auch unendlich kleine, Zeitdifferenz handelt, die jedoch das Nacheinander beibehält. Aber von Parallelismus, also Ähnlichkeit der Raumqualitäten, kann kaum gesprochen werden, zumal wir über die Räumlichkeit der Hirnprozesse kaum etwas wissen. Im Gegenteil, alles weist darauf hin, daß die im Bewußtsein als einheitlich erscheinenden Erlebnisse physiologisch in höchst komplizierter Zusammenarbeit vieler, räumlich getrennter Hirnpartien entstehen, so daß von „Parallelismus“ gewiß nicht gesprochen werden kann.
Das Rätselhafteste an dem ganzen Geschehen ist jedoch, daß das Bewußtsein unmittelbar von den ihm angeblich parallel laufenden Hirn Vorgängen auch nicht das geringste weiß, nicht einmal, daß sie stattfinden. Inhaltlich ist das Bewußtsein überhaupt nicht auf physiologische Prozesse bezogen, sondern auf die an sich außerbewußten „Gegenstände“, die es – unter Überspringung auch der Strahlung – unmittelbar wahrzunehmen glaubt, ja, mit denen es das subjektive Erleben identisch setzt, so, wenn es den Baum „grün“ nennt, wo doch die Grünempfindung nur als Bewußtsein erlebt wird. Hier wird also nicht bloß ein Parallelismus, sondern sogar Identität zwischen Übersetzung und Original – diesmal dem materiellen – angenommen, was nachweisbar falsch ist. Von Übereinstimmung oder Gleichheit zwischen Bewußtseinserleben und Objekt kann gar nicht die Rede sein, höchstens von „Entsprechung“ oder „Übersetzung“, was der Phänomenalismus durch den Begriff der „Erscheinung“ ausdrückt. Das, was jedoch in der Wahrnehmung „erscheint“, ist nicht das sagenhafte „Ding an sich“, sondern sind physikalisch bestimmbare Tatsachen, die jedenfalls nicht bloß „Erscheinungen“ sind, auch wenn sie nicht absolute Erkenntnis der „Dinge“ sind.
Aber wenn auch nur „Übersetzungen“, so sind unsere Bewußtseinserlebnisse von den Dingen darum nicht völlig subjektiv, sondern, wie die Praxis des Lebens erweist, weithin ausreichend, um uns mit der Welt in einer für unser Handeln notwendigen Beziehung zu erhalten. Es ist sogar sehr fraglich, ob wir, wenn wir mikroskopische Augen hätten, damit „besser“ sehen würden. Die Übersetzung verhält sich zum Objekt so wie eine Landkarte zu dem Lande selbst, auf der nur das für eine räumliche Orientierung Notwendige eingetragen ist, die aber gerade dadurch brauchbar wird. Auch bei Übersetzungen aus einer Sprache in eine andere ist nicht immer die ganz wörtliche Übertragung die beste, sondern oft bringt eine freie Umgestaltung den Sinn treffender heraus. Die Übersetzung der Welt im Bewußtsein ist noch weitaus „freier“; schon die einfachste Wahrnehmung ist nicht ein Abbild, sondern eine Umbildung des Gegebenen, zugleich eine Auswahl [100] und eine Vereinheitlichung der Reize, eine Umbildung, die jedoch für das praktische Verhalten zur Welt weit besser geeignet ist, als es ein getreues „Abbild“ wäre, ähnlich wie eine Landkarte sich besser für die Orientierung eignet als ein mit allen Einzelheiten ausgeführtes Bild. Das aber gilt für alles Bewußtsein, das nicht bloß ein reproduktives, sondern ein höchst produktives Verhalten zu den Dingen ist. Unser Bewußtsein von der Welt ist nicht eine getreue Spiegelung, sondern eine freie Umgestaltung, eine Symbolik, deren Wert nicht auf der „Ähnlichkeit“ mit der Welt, sondern in ihrer praktischen Brauchbarkeit beruht.
Innenwelt und Außenwelt
Ein weit verbreiteter, wenn auch zumeist wohl nur gedankenlos nachgesprochener Irrtum ist der, das Bewußtsein sei eine „Innenwelt“, die von der materiellen „Außenwelt“ klar geschieden sei. Indessen, die räumliche Scheidung „innen“ und „außen“ gilt höchstens für die physiologischen Prozesse, die tatsächlich „im Gehirn“, vor sich gehen. Aber – und wieder zeigt sich die Unzulänglichkeit des Parallelismus – das Bewußtsein ist nicht im Gehirn und nicht in der Seele, sondern es dringt in die Außenwelt hinein. Es ist schlechthin nicht wahr, daß ich das Grün der Bäume vor meinem Fenster oder den Ton der Glocken des fernen Kirchturms im Hirn erlebe, sondern das Grün erlebe ich dort, wo die Bäume stehen, und den Glockenklang höre ich „in der Ferne“. Dieser für alles praktische Handeln außerordentlich wichtige Tatbestand ist nur möglich durch die Überspringung, das heißt das Nicht-Bewußtwerden einerseits der Strahlungswirkung und der physiologischen Prozesse, andererseits auch der Bewegungsakte, die die Lokalisation bedingen. Dadurch glauben wir die Wahrnehmung nicht im Hirn, sondern „an“ den Gegenständen zu erleben. Aber auch Vorstellungen und Gedanken erleben wir nicht im Gehirn, sondern, wenn auch nicht immer klar lokalisiert, als außerhalb des Hirns. Das verraten schon sprachliche Ausdrücke: der Begriff „vor-stellen“ meint, unter anderem, ein „Vor-sich-Hinstellen“; und man sagt, man „sei in Gedanken bei einem Gegenstande“, die Gedanken „schweiften in die Ferne“. Und jedenfalls habe ich, wenn ich an Rom denke oder es mir vorstelle, nicht das Bewußtsein, daß das in meinem Gehirn geschieht, sondern es schwingt ein vages Bewußtsein von Ferne und sogar einer Richtung mit.
Also nicht eine vermeintliche „Innerlichkeit“ ist das Wesen des Bewußtseins, sondern gerade der unleugbare Tatbestand, daß es uns die „Außen“-Welt erschließt, daß es ein Außendienst des Ich ist. Denn nicht nur die Wahrnehmung, auch das Denken ist zumeist Außendienst. Wenn ich über die Spiralnebel oder über die Geschichte Karthagos nachdenke, so denke ich damit über Dinge, die weit „außerhalb“ meines Ich liegen. Eine „Grenze“ zwischen Bewußtsein und Welt besteht überhaupt nicht. Alle sonstigen Raumbegriffe versagen, wenn man sie auf das Verhältnis von Bewußtsein und Welt übertragen will. [101] Gewiß ist das Bewußtsein nicht völlig unräumlich, wie manche Philosophen behaupten. Es hat ein Zentrum im physiopsychischen Ich, aber es hat keine festlegbare Peripherie, es kann ins Unendliche hinausschweifen.
Besonders unmöglich erweist sich eine Grenzziehung zwischen Innenwelt und Außenwelt aber erst dann, wenn wir bedenken, daß unsere „Außenwelt“ ja nicht bloß aus „Dingen“ besteht, sondern auch aus Menschen, die ebenfalls eine „Innenwelt“ haben. Und daß deren Innenwelt uns nicht verschlossen ist, sondern wir mannigfach teilhaben daran, wie die ändern auch an unserer Innenwelt. Nicht nur, daß wir das Innenleben unserer Freunde mitleben; wir nehmen auch an Gedanken und Bestrebungen teil, die allen Kulturmenschen gemeinsam sind und als objektivierter Geist eine Existenzform haben, die weder rein subjektiv noch rein objektiv ist. Ja, wenn wir ein Buch lesen, so erscheint ihm gegenüber die Frage, ob der „Inhalt“ des Buches nun in meinem Kopf oder im Buche sei, geradezu absurd.
Kritisch betrachtet hat der Gegensatz zwischen Außenwelt und Innenwelt überhaupt nur einen Sinn, wenn man an den Leib denkt, der selbst ein räumlicher Tatbestand ist. Denn vom Leibe aus besteht eine „Grenze“ gegenüber der Außenwelt, und wenigstens die physiologischen Bedingungen des Bewußtseins vollziehen sich innerhalb des Leibes, auch die „Akte“ des Bewußtseins, während die „Inhalte“ oder besser das „Gegenständliche“ des Bewußtseins außerhalb des Leibes lokalisiert werden. Wenn man schon räumliche Begriffe aufs Bewußtsein selbst überträgt, so ist es nicht ein Innenleben, sondern gerade ein Außendienst, in Wahrheit eine Wechselwirkung, die das Äußere ins Innere zieht und das Innere in die, vom Leibe aus gesehen, Außenwelt hinaus verlegt. Wir können gewiß sagen: „das Bewußtsein ist in der Welt“; aber wir können auch sagen: „die Welt ist im Bewußtsein“. Und dadurch hebt sich ein wenig die Größendiskrepanz zwischen Welt und Bewußtsein, die sich uns zunächst als Problem stellte. Unser Bewußtsein, obwohl ans kleine Menschenhirn gebunden, vermag, indem es zu den Sternen aufschaut, doch tausend Sonnen zu umfassen. Wenn irgendwo, so gilt hier Goethes Wort: „Nichts ist drinnen, nichts ist draußen, denn was innen ist, ist außen.“
Die Wirklichkeit jenseits des Bewußtseins
Über das rein Räumliche hinaus geht jedoch das Problem, das die Erkenntnistheoriker vor allem beschäftigt hat, daß wir ja, obwohl wir im Auge nur das optische Bild, genau gesagt, nur die dort als Farbempfindungen wirkenden Strahlen erleben, doch nicht bloß Farben zu sehen glauben, sondern den Gegenstand selbst. Denn die Sprache sagt nicht, was korrekt wäre: „ich sehe die Farbstrahlen, die der Baum in mein Auge schickt“, sondern sie sagt: „ich sehe den Baum“; und der naive Realist glaubt in der Tat, er „sähe“ den Baum als festen, sich rauh anfühlenden Gegenstand mit allem Holz, das [102] hinter der Oberfläche ist; er meint, er sähe nicht bloß die optischen Eigenschaften, sondern auch die „Substanz“ des Baumes mit. Wir substantialisieren die Wahrnehmungen, indem wir ihnen eine „Substanz“ unterlegen, die wir nicht wahrnehmen können, die wir hinzudenken.
Hume und andere haben daraus den Schluß gezogen, es gäbe gar keine Substanz, weil wir sie nicht wahrnehmen können. Kant dagegen hat die Substantialität für eine notwendige Kategorie des Verstandes erklärt, eine Form, unter der wir die Empfindungen ordnen, die jedoch transzendentale, eine Objektivität konstituierende Geltung habe. Indessen wird der „gemeine Mann“ schwer zu überzeugen sein, daß die Härte und die Schwere eines Baumstammes nur seine subjektive Empfindung oder nur die kategoriale Setzung seines Verstandes sei. Er wird daran festhalten, daß jenseits seiner visuellen und taktilen Wahrnehmung eine Wirklichkeit existiere. Und die Physik und die Chemie stimmen hierin dem „gemeinen Manne“ durchaus bei.
In der Tat liegt der Fehler der Philosophen darin, daß sie glaubten, nur die Sinnesempfindungen gäben uns Kunde von der Außenwelt, und daß sie völlig übersahen, daß der Mensch nicht bloß durch sein Bewußtsein, sondern auch durch seinen Leib in Beziehung zur Außenwelt steht. Gerade als „Körper“ kommt unser Leib mit der körperlichen Umwelt in Beziehung. Die „Gegen-stände“ leisten seinem Körper Widerstand; sie stehen ihm entgegen, wenn er danach greift oder an sie stößt, was in der Philosophie als ihre „Undurchdringlichkeit“ bezeichnet wird.
Tatsächlich sind nicht bloß die Sinnesorgane, sondern der gesamte Körper, vor allem die Hand, Möglichkeiten des Bewußtseins, mit der Welt in Beziehung zu treten. Die Hand steht im Dienste des Geistes, und zwar nicht bloß als Trägerin des Tastsinnes, sondern vor allem als greifende, zupackende Hand, die die Gegenstände „behandelt“! Es ist kein Zufall, es liegt ein tiefer Sinn darin, daß die Sprache die meisten geistigen Akte durch körperliche Handlungen bezeichnet: „Er-fassen“, „Wahr-nehmen“, „Be-greifen“, „Vor-stellen“ und viele andere. Trotzdem hat die ältere Philosophie diese Beobachtungen der Sprache, die eine sehr gute Psychologin ist, völlig mißachtet und die Hand höchstens als Tastorgan, nicht aber als Organ des Greifens, Zupackens, kurz, alles „Handelns“ beachtet. Aber das Greifen ist etwas ganz anderes als das Betasten, obwohl gewiß Tastempfindungen auch dabei beteiligt sind. Es ist weit über bloßes Empfinden hinaus ein „Behandeln“, ein „Wirken“; und was sich darin erschließt, ist „Wirklichkeit“. Wenn zum Beispiel manche Theoretiker behaupten, wir könnten durch unsere Empfindungen nicht ermitteln, ob hinter den Empfindungen eine Wirklichkeit stünde, und daraufhin alle körperliche Wirklichkeit leugnen, so übersehen sie, daß die Hand als körperliches Organ uns durchaus mit der körperlichen Wirklichkeit in Verbindung bringt. Das stellt jeder Mensch fest, wenn er im Halbschlaf zweifelt, ob eine Vorstellung ein Traum oder eine wirkliche Wahrnehmung sei; dann greift er danach, und wenn er den Gegenstand, den er zu sehen glaubt, packt, so ist er von dessen Wirklichkeit überzeugt, ebenso wie die Jünger Jesu in Emmaus überzeugt waren von der [103] Wirklichkeit der Person des Heilands, als sie ihre Hand in seine Wunden legten. Vor allem aber dadurch, daß die Hand die ergriffenen Gegenstände selbst auf andere wirken läßt, stellt sie nicht bloß das Vor-„hand“ensein der „Substanz“, sondern auch ganz bestimmte Qualitäten daran fest. Nehme ich einen Hammer und schlage damit auf einen Stein, so erkenne ich dadurch Eigenschaften des Steins, die ich aus reinen Sinneseindrücken nie gewinnen kann. Ob der Stein sich spalten läßt, wie er beim Schlag klingt, und vieles andere kann ich dadurch feststellen, wobei die Sinnesempfindungen nicht die Quelle des Erkennens, nur die Registrierung von Tatsachen sind, die primär durch Hand und Hammer ermittelt werden. Und noch weit mehr läßt sich durch „Behandeln“ des Steins mit chemischen Stoffen über seine Substanz ergründen. Wir nannten die durch Wirkung der Dinge nicht direkt auf die Sinne, sondern durch die Wirkung der Dinge aufeinander gewonnene Erkenntnis die indirekte Erkenntnis und zeigten, daß die erstaunlichen Ergebnisse der Physik und Chemie nicht durch „Anschauen“, sondern durch „Behandeln“ der Dinge erbracht werden, wodurch eine höchst subtile und doch gesicherte Einsicht nicht nur in das Vorhandensein, sondern auch die Eigenschaften der Substanz gewonnen wurde, die weder Einbildung noch apriorische „Setzung“ des Geistes sind. Verwunderlich ist dabei, wie wenig die Kritiker Humes und Kants auf diese unzweifelhaften Tatsachen hingewiesen haben, wohl weil man den dogmatischen Bewußtseinsstandpunkt nicht preisgeben wollte. Die „Wirklichkeit“ führt diesen Namen mit Recht, nicht nur weil sie aufs Bewußtsein einwirkt, sondern auch weil das Bewußtsein durch den Leib auf die Wirklichkeit wirkt und weil deren Bestandteile in mannigfacher Wechselwirkung stehen, die unabhängig ist von unserem Bewußtsein. Der Fehler vieler idealistischer Philosophen ist der, daß sie das Bewußtsein des Gegenstands mit dem Gegenstand des Bewußtseins gleichsetzen. Gewiß enthalten die Begriffe „Salpetersäure“ und „Metall“ sogar mehr als die damit gemeinten Gegenstände, aber daß bei Übergießen des Metalls mit Salpetersäure die Wasserstoffatome der Säure durch Metallatome ersetzt werden, das ist ein Wirken und eine Wirklichkeit, die ganz unabhängig von unserem Denken sind.
Biologie und Bewußtseinstheorie. Die Umweltlehre
Auch durch die moderne Biologie ist die Bewußtseinsphilosophie um neue Tatsachen und auch Probleme bereichert. Zunächst muß die Behauptung fallen, daß der Leib schlechthin als „Materie“ zu behandeln sei, vielmehr zeigt die gründlichere Erforschung der Organismen, daß der Leib die Verachtung, mit der manche Idealisten ihn bedacht haben, in keiner Weise verdient, und daß er ein Wunderwerk ist, das um so mehr Staunen erregen muß, je genauer man ihn kennenlernt Gewiß gehen mannigfache chemische Prozesse in ihm vor sich, aber viele davon begreifen auch unsere fortgeschrittensten Chemiker nicht, geschweige denn, daß sie sie in ihren Retorten nachbilden könnten. Wohl [104] sehen viele Naturwissenschaftler den Leib als „Mechanismus“ an und behaupten, alles, was in ihm geschieht, mit physikochemischen Geschen erklären zu können. Indessen ist das ein uneingelöster Wechsel auf eine ferne Zukunft, und es gibt unter den heutigen Biologen sehr viele, die die Diskontierbarkeit dieses Wechsels grundsätzlich bestreiten. Gegenüber dem Mechanismus hat sich ein neuer Vitalismus erhoben, der im Leibe einen immateriellen Faktor, die „Entelechie“ annimmt, den man mit Begriffen, die aus der Bewußtseinswelt entnommen sind, wie „Plan“, „Zweckgerichtetheit“ usw. illustriert. Ja, die Entelechie wird vielfach als „seelenhaft“ bezeichnet und damit dem Bewußtsein nahegerückt, was mindestens die Psychovitalisten ganz offen tun, die im leiblichen Geschehen ein „Gedächtnis“ und andere zum „Bewußtsein“ oder doch zum „Seelischen“ zu rechnende Faktoren annehmen. Damit aber kehren sich alle Perspektiven um: nicht das Seelische wird aus dem Leiblichen, sondern das Leibliche wird aus dem Seelischen erklärt, mindestens das Leben des Leibes, das nicht bloß Materie ist, aber auch nicht bloß Bewußtsein. Das Leben als ein von der Materie zu unterscheidender Vorgang ist daher zu einem Zentralproblem der Philosophie der letzten Jahrzehnte geworden, nachdem es die älteren Philosophen nur höchst nebenher behandelt haben. Die Welt besteht nicht bloß aus Materie und Bewußtsein, auf welche Zweiheit die älteren Philosophen sie zumeist beschränkten. Zwischen beiden, als unentbehrliches Zwischen- und Vermittlerglied, steht das Leben, das vor allem ein Wirken ist, das in seinen höheren Formen auch Bewußtsein einschließt. Damit verliert aber das Bewußtsein die Selbständigkeit, die ihm in den idealistischen Systemen zugeschrieben wurde, in denen das „Leben“ oft überhaupt nicht erwähnt, sondern die Welt als bestehend aus „Dingen“ oder „Materie“ einerseits und aus „Bewußtsein“ oder „Geist“ andererseits hingestellt wird, was zweifellos unzureichend ist.
Dazu kommt weiter, daß die Biologie zeigen kann, daß Bewußtsein nicht bloß beim Menschen vorkommt und auch bei ihm nicht bloß als die „reine Vernunft“, von der die Erkenntnistheoretiker vorwiegend sprechen, sondern daß in der Tierwelt das Bewußtsein, das anfangs in ganz primitiven Formen als dumpfes „Wachsein“ auftritt, sich erst allmählich entwickelt hat, und daß es zunächst keineswegs theoretisches Wissen ist, sondern im Dienste praktischer Lebensaufgaben steht: der Ernährung, der Sicherung, der Fortpflanzung. Und auch beim Menschen ist das Wesen des Bewußtseins in erster Linie auf vitale Notwendigkeiten gerichtet, nicht auf reines „Wissen“. Es ist kein passiver Spiegel, der die Welt abbildete, sondern steht im Dienste eines Wirkens, das allerdings weit über bloße Lebenserhaltung hinausführt und sich als Kulturbetätigung darstellt. So gesehen aber steht das Bewußtsein dem Weltgeschehen nicht gegenüber, sondern gehört als dienendes Glied in das Weltgeschehen hinein.
Die herkömmliche Trennung der Welt in Bewußtseinssubjekte und Bewußtseinsobjekte ist eine Abstraktion, die dem ganzen Tatbestand nicht gerecht wird. Richtiger wäre es, von Wirksubjekten und [105] Wirkobjekten zu sprechen, wobei das Bewußtsein sich nur als Teilfaktor eines Wirkens darstellt, in dem sich das Bewußtsein objektiviert und die Objekte zu Trägern eines objektiven Geistes macht, der sich zwar im individuellen Bewußtsein subjektivieren muß, aber selbst keineswegs bloß „Objekt“ ist.
In unserem Zusammenhang, für die Erkenntnis des Bewußtseins und sein Verhältnis zur sogenannten Außenwelt sind die biologischen Einsichten wichtig, die sich vor allem an den Namen J. von Uexkülls knüpfen, die aber auch für die philosophische Problematik des Bewußtseins sehr erhellend sind. Dieser Forscher nämlich hat zunächst für die Tiere dargelegt, daß sie innerhalb derselben „Umgebung“ in sehr ungleicher „Umwelt“ leben, und zwar jedes Tier in seiner ganz spezifischen „Umwelt“, also daß der Regenwurm in einer Regenwurmwelt, die Libelle in einer Libellenwelt, der Mensch aber in einer Menschenwelt lebt. Unter Umgebung ist dabei die gesamte materielle Umgebung verstanden, während als Umwelt nur das gilt, was aus der Umgebung erlebt wird, also die „Merkwelt“, die allerdings zugleich „Wirkwelt“ ist.
Jedes Tier nämlich erlebt aus seiner Umgebung nur das, worauf seine Instinkte, seine Merk- und Wirkorgane, eingestellt sind; alles andere bleibt außerhalb seines Bewußtseins; es bemerkt nur, was es für sein Leben braucht, für seine Ernährungs-, Sicherheits- und Geschlechtsinstinkte; das aber findet es mit einer den beobachtenden Menschen oft verblüffenden Sicherheit und vermag es sinngemäß seinen Bedürfnissen unterzuordnen. Diese Fähigkeiten hat es nicht aus Erfahrung, es bringt sie mit seiner Organisation zur Welt; es ist gleichsam „abgestimmt“ darauf. Mit Recht bezeichnet man die „Um“-Welt nicht als „Außen“-Welt; indem man „Um“-Welt sagt, will man eine feste Beziehung zwischen dem Subjekt und den von ihm erlebten Objekten der Umgebung ausdrücken, also daß das Tier mit seiner Umwelt sozusagen ein einheitliches Ganzes bildet, wie es denn zumeist auch zugrunde geht, wenn es in ganz fremde Umgebung, in der es seine Umwelt nicht findet, versetzt wird. Anfechtbar ist höchstens der Begriff Um-„Welt“; denn um eine „Welt“ im Sinne einer Ganzheit des Seienden handelt es sich bei den Tieren nicht, sondern gerade um einen sehr begrenzten Ausschnitt aus der gesamten Welt. Besser wäre zu sagen: Um-„Wirklichkeit“; denn das, was zum Bewußtsein kommt, ist nur das, was irgendwie das Wirken des Tieres auslöst. Der Laie meint, die objektive Einwirkung äußerer Reize bedinge ihr Bewußtwerden und das Wirken; in Wahrheit entscheidet die Wirkdisposition der Instinktanlage, also letztlich eine Wertung darüber, ob ein äußerer Reiz zum Bewußtsein kommt.
Ein Beispiel möge das illustrieren. Physisch gesehen leben die Stubenfliege, der Hund und der Mensch in „demselben“ Zimmer, also „derselben“ Umgebung; psychisch gesehen jedoch leben alle drei in ganz verschiedenen Umwelten, weil ihre Wirkdispositionen völlig verschieden sind und daher ganz verschiedene Objekte zum Bewußtsein bringen. Die Fliege, die mich beim Schreiben umschwirrt, [106] sieht weder den Tisch, noch die Bücher, noch mich, sie sieht vermutlich überhaupt sehr wenig, wahrscheinlich unterscheidet sie mit ihren Facettenaugen nicht viel mehr als helle und dunkle Flecke, die auf keinen Fall für sie Tisch, Bücher, Mensch bedeuten. Dagegen riecht sie viel mehr als der Mensch und nimmt infolge ihrer Riechfähigkeit eine Menge dem Menschen kaum erkennbare winzige Objekte wahr, die ihr zur Nahrung dienen können und die sie mit ihrem Saugrüssel sich einverleibt. – Auch für den Hund, obwohl er viel mehr sieht als die Fliege, ist doch der Tisch kein Tisch, sondern höchstens ein Ding, unter das er sich legen, auf das er aber nicht hinaufspringen darf, wenn es nicht Strafe geben soll. Und die Bücher sind für den Hund keine Bücher, sondern völlig gleichgültige Dinge, die er gar nicht beachtet, weil er nichts damit „machen“ kann. – Nur für den Menschen ist ein Tisch ein Tisch, das heißt ein Ding, an dem man sitzen und auf dem man schreiben kann und sind Bücher Bücher, das heißt Dinge, in denen man lesen kann, die der Mensch aber auch nur beachtet, wenn seine Tätigkeit darauf eingestellt ist, die er jedoch, obwohl sie vor ihm liegen, gar nicht „sieht“, wenn er angeregt mit einem Besucher plaudert. Indessen auch Mensch und Mensch ist nicht daßelbe, und sie sehen nicht alle daßelbe, sondern nur das, worauf ihre Tätigkeit eingestellt ist. Denn für das Stubenmädchen ist der Tisch nicht derselbe Tisch wie für mich, dein er zum Schreiben dient; er ist zwar auch für Minna ein Tisch, aber in ihrem Fall ein Ding, das abgestaubt werden muß. Und da sie auf Abstauben eingestellt ist, so sieht sie vor allem den Staub, den ich wiederum wenig beachte. Kurz, in der gleichen Umgebung kommen jedem Wesen ganz verschiedene Objekte zum Bewußtsein, und entscheidend für die Auswahl ist nicht das Einwirken äußerer Reize, die auf alle einwirken, sondern die Tätigkeitseinstellung des spezifischen Subjekts.
Die Ergebnisse der Umweltlehre sind in mehrfacher Hinsicht auch für die Bewußtseinslehre aufschlußreich und neue Perspektiven eröffnend. Sie widerlegen zunächst die Meinung der naiven Realisten und der Materialisten, die da meinen, das Vorhandensein der materiellen Gegenstände sei ausschlagebend für deren Bewußtwerden und dies Bewußtsein sei überall gleich. Sie rücken dafür ins Licht, daß mindestens ebenso wichtig die besondere Art und speziell die Tätigkeitseinstellung des Subjekts dafür ist, ob und wie ein Gegenstand zum Bewußtsein kommt. Sie widerlegen aber auch weiter die Meinung der Idealisten, daß die Gegenstände in erster Linie Bewußtseinsgegenstände seien und daß die Kategorien des Bewußtseins, die bei allen Menschen gleich seien, darüber entschieden, wie der Gegenstand bewußt werde. Die Beziehungen des Menschen zur Welt sind unendlich vielfältiger, als die Kantsche Tafel der Kategorien annimmt. Jeder Mensch lebt letztlich in seiner eignen Welt, und wie diese beschaffen ist, hängt sehr wesentlich vom Menschen ab. Der Mensch aber ist nicht wie das Tier ausschließlich Individuum oder Gattungswesen, sondern er hat stets eine typisch-kulturelle Prägung, und auch diese redet – neben den biologischen Anlagen – entscheidend mit bei [107] dem, was seine „Welt“ ist. Die biologische und psychologische Betrachtung muß also ergänzt werden durch die soziologische.
Soziologie des Bewußtseins
Indem wir das menschliche Erleben mit dem der Tiere verglichen, stellen wir den Menschen keineswegs mit den Tieren auf gleiche Stufe. Denn das Bewußtsein des Menschen ist grundsätzlich von dem der Tiere verschieden, mag es auch in seinem seelischen Unterbau manches mit dem Tiere gemein haben. Gewiß können wir den höheren Tieren „Seele“ zusprechen, der Mensch aber hat darüber hinaus etwas, was kein Tier besitzt: er hat Geist, und dadurch rückt sein Bewußtsein auf eine ganz andere, höhere Ebene. Der Mensch nämlich ist nicht wie das Tier bloß „Natur“, sondern er ist, wie er selbst durch seinen Geist Kultur schafft, auch selbst ein Kulturprodukt. Denn Kultur ist objektivierter Geist und Geist ist subjektive Kultur.
Wir sagten oben, daß es „den“ Menschen überhaupt nicht gibt, wenigstens nicht in der gleichen Weise, wie es „den“ Regenwurm oder „den“ Sperling gibt; denn alle Regenwürmer und alle Sperlinge verhalten sich in arttypischer Weise, sie bohren ihre Löcher und bauen ihre Nester in ziemlich gleicher Form. Die Menschen jedoch verhalten sich weit verschiedener, und aus ihrer „Natur“ ist nicht abzuleiten, wie sie ihre Häuser bauen und wie sie ihre Nahrung beschaffen. Das mußten sie in ihrer Kulturgruppe lernen. Zwar innerhalb einzelner Kulturkreise bestehen gewisse typische Formen, aber die Kulturen untereinander unterscheiden sich tiefgehend, also daß der Häuserbau, die Sprache, ja, die Denkformen der Fidschiinsulaner und der Europäer, der Grönländer und der Chinesen sich weit mehr voneinander unterscheiden als Nesterbau oder Ausdrucksformen ganz verschiedener Tierarten. Das Wesentliche aber ist, daß diese Unterschiede bei den Menschen nicht natur-, sondern kulturbedingt sind, und daß durch seine besondere kulturelle Umgebung der einzelne ein überindividuelles Gepräge erhält. Gewiß bestehen in jeder Kultur auch individuelle Unterschiede, die jedoch ebenfalls sehr wesentlich kulturell bedingt sind; denn wenn, wie gesagt, das Stubenmädchen und der Gelehrte die gleichen Gegenstände ganz verschieden erleben, so liegt das nicht allein an individuellen Naturanlagen, sondern diese sind ausgebildet durch die verschiedene kulturelle Einstellung, die beim Stubenmädchen auf das Reinerhalten, beim Gelehrten auf seine Forschung zielen.
Mit diesen Betrachtungen wenden wir auf das Bewußtsein, das die idealistischen Philosophen als allgemein-menschliche Tatsache ansehen, die Blickweise und die Ergebnisse der Soziologie an, die neben Psychologie und Biologie die Erkenntnis vom menschlichen Geiste sehr wesentlich umgestaltet hat und von der die älteren Philosophen noch nichts wissen konnten. Zusammen mit der „Völkerpsychologie“ oder, wie man besser sagt, der Sozialpsychologie, hat [108] die Soziologie gezeigt, daß das Verhalten verschiedener Kulturtypen sich weit tiefer unterscheidet, als man früher ahnte. Selbst jene Denkformen, die Kant als für alles Denken, das göttliche inbegriffen, verbindlich ansehen, die Sustantialität oder Kausalität, sind in verschiedenen Kulturkreisen, wenn überhaupt vorhanden, so doch völlig verschieden ausgestaltet. ...
(========================[109] ... Wenn man dabei von überindividuellem Bewußtsein spricht, so ist das nicht ganz korrekt; richtiger spricht man von überindividuellem Geiste; denn Geist umfasst mehr als nur Bewußtsein, und schon die Sprache ist nicht bloß Bewußtsein, sondern auch ein körperlicher Akt und als solcher zunächst auf andere Menschen wirkend. Noch weniger sind die Schrift, sind Bücher, Gemälde, Instrumente, Baulichkeiten, Institutionen, die auch zum „Geist“ und zur „Kultur“ gehören, bloß Bewußtsein; sie sind objektivierter Geist und wirken als solcher „bildend“ auf die Individuen und ihr Bewußtsein zurück. Wir kommen damit also „von unten“, d. h. von der Erfahrung ausgehend, scheinbar zum gleichen Ergebnis wie die Idealisten, die „von oben“ ausgehend ein überindividuelles Bewußtsein annahmen, richtiger einen überindividuellen Geist; aber wir begründen es anders: denn jeder „Volksgeist“, jeder „Kulturgeist“ ist nur möglich auf Grund an sich außerbewusster Objektivationen. Was wir überindividuellen Geist nennen, ist nicht eine halbmystische Intuition, sondern ein aus Tatsachen abgeleiteter und an Tatsachen zu verifizierender Begriff.
Besonders markant tritt das Überindividuelle in jenen Tatbeständen heraus, die sich als sittliches Gewissen, als ästhetischer Geschmack, als logische Wahrheitswertung dem Bewußtsein überordnen, und wovon insbesondere das Gewissen von Kant als metaphysischer Tatbestand geschildert wird. Alles das ist überindividuell, aber nicht im metaphysischen Sinne, sondern im sozialen. Es hängt sehr von der Kulturumgebung ab, was einer aus „seinem“ Gewissen, „seinem“ Geschmack, „seinem“ Wahrheitswertung heraus billigt oder verwirft. Zugegeben, daß eine allgemeine Anlage dazu bei allen Menschen existiert, obwohl es Individuen gibt, von denen man sagt, sie hätten „kein“ Gewissen, „keinen“ Geschmack, „kein“ Urteil; aber die [110] spezielle Form, in der sich alles das auswirkt, stammt nicht nur aus den tiefen des Ich, sondern aus der kulturellen Umgebung. ...
Jedenfalls tritt in der soziologischen Betrachtung klar heraus, daß das Bewußtsein der Einzelmenschen weder eine Naturtatsache, noch bloß die Individuation eines allgemeinen Bewußtseins ist, sondern - was es auch sonst sei - in jedem Menschen tiefgehend geformt wird duch die soziale Umgebung, den Kulturkreis und die Aufgaben, die der Einzelmensch darin zu erfüllen hat.
Das Bewußtsein als Funktion der Kultur
...
Nur wenige Menschen sind sich klar darüber, daß das Wissen, das sie oft recht widerwillig in der Schule erlernen und worüber sie später als selbstverständlichen Besitz verfügen, durch mühsame Arbeit vieler Generationen erworben und überliefert wurde. ... Aber alles das gehört auch zur Vorgeschichte „unseres“ Bewußtseins, einer vorgeschichte, die nicht ein passives Erleben der Welt, sondern ein aktives Wirken, Kämpfen, Erobern [111] war und nicht den Menschen der Welt, sondern die Welt dem Menschen unterzuordnen strebte. Die Geschichte der Erkenntnis ist, einer schrittweisen Unterwerfung der Welt durch den Geist, nicht von Einzelmenschen, sondern wohlorganisierten und mit mannigfachen Waffen, Apparaten, Büchern ausgestatteten Gruppen ausgeführt. Und sie ist nicht bloß Wissen, sondern praktische Beherrschung der Welt.
...
[112] ...
Das Schöpferische des Bewußtseins
... [113] ... [114] ... Sehen wir als die kosmische Aufgabe des Menschen die Schaffung von Kultur an, so liegt seine Aufgabe jedenfalls nicht im bloßen Wissen um eine vorgefundene Wirklichkeit, sondern gerade in deren Umgestaltung. Diese aber ist nur dadurch möglich, daß zum Bewußtsein über wirklichkeitsentsprechendes Wissen hinaus auch eine mit der Wirklichkeit frei spielende Phantasie tritt, die gewiss ihr Material aus der Wirklichkeit bezieht, aber es schöpferisch umgestaltet. Die meisten Kulturgebilde sind das, was Ibsens Baumeister Solneß für „das Schönste in der Welt“ erklärt: „Luftschlösser, aber mit einem festen Fundament darunter“. Der Sinn des menschlichen Daseins und Bewußtseins erschöpft sich nicht im Abspiegeln einer vorhandenen Welt; das ist, soweit es überhaupt möglich ist, nur ein Mittel, um die Welt umzugestalten, eine Überwirklichkeit zu schaffen, die auch den Menschen über sich selbst, seine Natur hinaushebt, Zielen zu, die sein Bewußtsein nicht weiß, denen es aber dient.
Die genetische Einheit des Bewußtseins
... [115] ... [116] ... (vor der kulturellen evolution lag die genetische des individuums als teil der welt [WH])
Das Problem eines kosmischen Bewußtseins
[117] ... [118] ... Die Welt stellt sich als höchst wunderbares Sinnesgeschehen dar, das wir anerkennen [119] müssen, auch wo wir es in der Tiefe nicht erkennen und nicht verstehen können. Ob ein irgendwie nach menschlichem Vorbild personal oder bewusst zu denkender Urheber dafür anzunehmen sei, ist nicht Sache des Wissens, sondern des Glaubens. Das ist das einzige, was die Wissenschaft zu diesem Problem feststellen kann. ...
========================)
[151]
...
Formale Logik und materielle Wahrheit
Das die Sprache ein wesentlicher Weg zur Erkenntnis und zur Wahrheit ist, haben zwar nicht theoretisch, aber doch praktisch die formalen Lokiker seit Aristoteles anerkannt; denn sie behaupten zwar vom Denken zu reden, sie reden jedoch in erster Linie von der Sprache, was schon die Bezeichnung „Logik“ zugibt; denn „logos“ heißt in erster Linie „Wort“ und erst in zweiter Linie „Gedanke“ oder „Begriff“. Und der Pragmatist F. C. S. Schiller hat in seinem [152] geistvollen Buche „Formal Logic“ durchgeführt, daß die Logiker nicht vom richtigen Denken, sondern nur vom richtigen Sprachgebrauch handeln, der jedoch als solcher, wie wir zeigten, für die „Wahrheit“ sehr wesentlich ist.
Der Grundgedanke der formalen Logik ist der, daß entscheidend für die Wahrheit des Denkens die richtige Form sei, eine „Form“, die freilich konkret nur als Form der sprachlichen Fassung, nicht des Denkens zu packen ist. Denn für andere Menschen wird die „Form“ unseres Denkens nur offenbar durch die sprachliche „Formulierung“, die wir ihm geben, und nur nach dieser kann das Denken beurteilt werden, mindestens nur diese ist kontrollierbar. Genau besehen freilich reden die Logiker jedoch nicht einmal von der lebendigen Sprache, der gesprochenen Sprache, sondern nur der geschriebenen, von dem, was sich davon schreiben läßt: denn die gesprochene Sprache ist weit reicher; die Schrift erfaßt sozusagen nur ihr Skelett, während vieles, wodurch wir im lebendigen Sprechen die Gedanken nuancieren: Tonfall, Klangfarbe, Tempo, Akzentuierung und anderes ganz unter den Tisch fällt, obwohl dadurch – zum Beispiel im ironisierenden Sprechen – der Sinn eines Satzes in sein Gegenteil verkehrt werden kann. Denn nenne ich, mit ironischer Betonung, einen kleinen Menschen einen „Riesen“, so bedeutet das, daß er in Wahrheit ein Zwerg sei. Auf alles derartige jedoch geht die Logik nicht ein, die da glaubt, es gäbe einen allgemeingültigen Sinn der Worte, und wenn man den festgelegt und erfaßt habe, sei die Wahrheit einer Aussage garantiert. Die sprachliche und begriffs-geschichtliche Forschung entscheidet durchaus gegen die Voraussetzung der Logiker. Der Begriff des Atoms ist heute ein vollkommen anderer als zur Zeit Demokrits, und kein Sokrates hätte durch dialektische Künste aus dem antiken Begriff des Atoms herausentwickeln können, was alles die heutige Physik an wundersamen Wahrheiten darüber erbracht hat.
Als erste Hauptaufgabe sieht die formale Logik die exakte, allgemeingültige Definition der Begriffe an. Definition heißt „Abgrenzung“, und sie zielt dahin, festzulegen, was unter einem Worte berechtigterweise zu denken sei. Im Hintergrund steht dabei der rationalistische Glaube, die Wirklichkeit sei aus klar abgrenzbaren, „allgemeinen“ Tatbeständen aufgebaut, die in Begriffen restlos zu erfassen seien. Schon das ist nachweisbar ein Irrtum; denn es gibt allenthalben Tatsachen, die sich nur unter starken Einschränkungen in einen allgemeinen Begriff fassen lassen. So rechnet man das Schnabeltier zu den Säugetieren, obwohl es Eier legt, einen Schnabel ähnlich den Vögeln hat und in seinem Körperbau, der geringen Blutwärme und vielen anderen Merkmalen den Reptilien weit näher steht als den höheren Säugetieren. Ordnet man also das Schnabeltier den Säugetieren zu, weil es in der Tat seine Jungen durch Sekrete seines Körpers nährt, so muß man den Begriff der Säugetiere viel weiter fassen, als es gemeinhin geschieht, wenn dieser Begriff der Wirklichkeit gerecht werden soll. Es gibt tatsächlich keinen Begriff, der endgültig [153] abzugrenzen wäre, und jeder Begriff der Wissenschaft kann durch neue Entdeckungen ins Ungeahnte erweitert werden. So ist der Begriff des Atoms, den man noch am Ausgang des neunzehnten Jahrhunderts als kleinste unteilbare Einheit der Materie definierte, heute völlig umgewandelt, wo man weiß, daß die Atome aus oft sehr zahlreichen auch selbständig auftretenden Teilen zusammengesetzt sind. Der Glaube, durch feste Definitionen die Wahrheit ermitteln zu können, ist unhaltbar; vielmehr zeigen alle Wissenschaften, daß die Begriffe in ständigem Flusse sind. Die logisch korrekte Definition, die „Form“ eines Begriffes, garantiert allein nicht die Wahrheit. Viele scharfsinnige Definitionen des Mitteltalters waren formal völlig korrekt, aber material falsch. Eine formal korrekte Definition garantiert nicht einmal die Existenz des definierten Begriffs. Die Scholastiker definierten zwar den Begriff „Gott“ in sehr subtiler und formal korrekter Weise; aber daß deshalb, wie der ontologische Gottesbeweis behauptet, auch die Wahrheit dieses Begriffes im Sinne der Existenz bewiesen sei, das hat schon Kant widerlegt. Die formal-logische Definition ist eine wertvolle Hilfe für das Sich-Verständigen; eine Garantie für die Wahrheit der definierten Begriffe im Sinne exakter Wirklichkeitsentsprechung ist damit nicht gegeben.
Mit der Annahme, daß die formale Richtigkeit einer Begriffsbestimmung die Wahrheit des Begriffs garantiere, fällt natürlich auch die absolute Wahrheitsgarantie der formal-logischen Urteilslehre. Ein Urteil ist ein In-Beziehung-Setzen zweier Begriffe, um dadurch eine neue Erkenntnis zu gewinnen, und die Logik behauptete, durch formale Korrektheit der Urteile werde auch ihre Wahrheit garantiert. Indessen gibt es viele Urteile, die formal ganz korrekt sind, aber inhaltlich falsch. Wenn zum Beispiel, wie Locke berichtet, ein König von Siam einem Reisenden gegenüber die Möglichkeit bestritt, daß Wasser zuweilen fest werden könne, so hätte er das in die logische Form kleiden können, daß es zum Begriff des Wassers gehöre, flüssig zu sein, und das Urteil, ein fester Körper sei Wasser, wäre danach unmöglich richtig. Das wäre formal-logisch korrekt gedacht, aber trotzdem irrig.
Aus der Begriffs- und Urteilslehre baut die Logik darüber hinaus ihre Lehre vom schlußfolgernden Denken, das entweder – auf deduktivem Wege – vom Allgemeinen aufs Besondere, oder – auf induktivem Wege – vom Besonderen auf das Allgemeine schließt. Indessen weiß man heute, daß sich das Denken nicht auf diesen fest-umrissenen Pfaden bewegt, und schon Mephisto hat jene Theorien mit überlegener Ironie verspottet:
„Zwar ist's mit der Gedankenfabrik
wie mit einem Weber-Meisterstück,
wo ein Tritt tausend Fäden regt,
die Schifflein herüber-, hinüberschießen,
die Fäden ungesehen fließen,
ein Schlag tausend Verbindungen schlägt.
Der Philosoph, der tritt herein,
und beweist euch, es müßt' so sein:
[154]
das Erst' wär' so, das Zweite so,
und drum das Dritt' und Vierte so;
und wenn das Erst' und Zweit' nicht wär',
das Dritt' und Viert' wär' nimmermehr.
Das preisen die Schüler aller Orten,
sind aber keine Weber geworden.“
Nur wenige Denker nehmen heute an, daß die formale Logik neue Wege zur Wahrheit, die stets material ist, erschließe. Sie ist als methodische Hilfe nützlich, aber Neues wird durch sie nicht entdeckt. Denn, wie J. St. Mill gezeigt hat, im „Allgemeinen“ ist schon das „Besondere“ enthalten. Und auch die Induktion erbringt Neues nur dann, wenn die besonderen Fälle, aus denen ein Allgemeinbegriff abgeleitet wird, nicht schon bekannt sind, sondern erst gefunden werden, was nicht auf formal-logischem Wege geschieht. Die Bedeutung der formalen Logik sieht man heute nicht in positiver Wahrheitsermittlung, sondern darin, daß sie ermöglicht, gewisse typische Denkfehler als solche zu erkennen. Der Glaube mitteltalterlicher Scholastiker, durch formale Logik, vor allem deduktive Schlüsse, zur Erkenntnis der Gesamtwelt, Gott einbegriffen, gelangen zu können, gilt heute zumeist als Aberglaube.
Das problemsetzende Denken als Weg zur Wahrheit
Weder die Begriffsbildung allein noch die formallogische Regelung allein erschöpfen das Wesen des Denkens als Mittel der Wahrheitsfindung. Das Erschließen neuer Wahrheiten geht nicht auf den normierten Wegen der formalen Logik vor sich, so wenig wie man neue Länder auf asphaltierten Chausseen entdeckt hat. Wie es für diese Entdeckungen nötig ist, allerlei Möglichkeiten zu erproben, deren viele in die Irre führen und oft gar nicht direkt auf das Ziel hinweisen, so arbeitet das Denken, das ein ungelöstes Problem zur „Wahrheit“ klären will, zunächst oft mit vielerlei Annahmen und Hypothesen, die durch Hilfsuntersuchungen gestützt werden müssen, bis endlich die Wahrheit herausspringt. Die logische Formulierung erfolgt erst nachträglich und dient zur Sicherung und Mitteilung des Ergebnisses. Schöpferisch, das heißt neue Wahrheiten findend, wird das Denken nur als problemlösendes Denken.
Voraussetzung ist zunächst die Ergreifung eines Problems, das zu lösen ist und das in seiner Gerichtetheit möglichst klar herausgearbeitet werden muß. Dann erfolgt der zweite Akt des Verfahrens, die Problembearbeitung. Diese pflegt in der Regel so vor sich zu gehen, daß man aus vorhandenem Wissen heraus die Lösung zu gewinnen sucht; da das aber selten ohne weiteres gelingt, werden durch Beobachtungen, Befragen anderer Personen, Nachschlagen in Büchern, Experimente, Aufstellung von Hypothesen und durch ähnliche Hilfsakte neue Materialien herangeschafft, die für die Lösung dienlich sein können. Erst auf Grund dieser Hilfsakte pflegt, oft in [155] überraschender Weise, das Resultat hervorzutreten, das dann, im dritten Akt, der Problemlösung, als Wahrheit erwiesen wird, indem es nach allen Seiten gestützt, und „verifiziert“ wird. Das ganze Verfahren hat eine sehr methodische Form in der mathematischen Gleichung gefunden. Auch hier wird zunächst eine Unbekannte, ein x, als Problem herausgehoben und mit allerlei teils bekannten Größen (a, b, c) und anderen Unbekannten (y, z) in feste Beziehung gebracht. Dann werden die anderen Unbekannten in besonderem Verfahren ermittelt, und auf Grund dieser Hilfsakte wird das x isoliert und durch die bekannten Größen genau bestimmt. Die Richtigkeit der Rechnung wird dann oft durch praktische Anwendung oder sonstige Beweise verifiziert.
Als Beispiel nehme ich das Problem der biologischen Abstammung des Menschen, das ja nicht bloß einen Forscher, sondern eine ganze Armee von Forschern beschäftigt hat. Als Problem trat es erst in voller Klarheit heraus, nachdem Darwin das Hervorgehen vieler Tierarten aus niederen Arten in eine klare Theorie gebracht hatte. In früheren Jahrhunderten war das Problem gar nicht erörtert worden; da nahm man den Menschen, wie die Arten der Tiere und Pflanzen, als stabile Schöpfungen Gottes hin. Nachdem aber Darwin die Abstammung höherer Tierarten von niederen erwiesen hatte, war die Ausdehnung der Problematik auf den Menschen eine Denknotwendigkeit; das Problem war gestellt und formuliert.
Man versuchte nun es zu lösen, indem man den Begriff des Menschen, so wie er bekannt war, mit den Begriffen von höheren Tieren und insbesondere der Menschenaffen, soweit man sie damals kannte, verglich und danach kühne Behauptungen aufstellte, die sich freilich nicht halten ließen. Indessen beruhigte man sich dabei nicht, sondern durchsuchte die Erde, um Reste von Wesen zu finden, die die unabweisbare Kluft zwischen Mensch und Affe zu überbrücken geeignet wären. Man suchte also diese weiteren Unbekannten zu ermitteln. Dazu setzte auch gründlichere Erforschung der Affentypen ein, die man bisher als „bekannt“ angenommen hatte, und nicht nur biologisch, auch psychologisch wurden Affen in besonderen Stationen beobachtet. Das war der zweite Akt, die Problembearbeitung, die nicht bloß durch abstrakt-logische Schlüsse, sondern durch tausendfältige Beobachtung, anatomische Untersuchungen, Experimente und andere Hilfsakte durchgeführt wurde. Der dritte Akt, die Problemlösung, ist noch nicht abgeschlossen, wenn auch negativ heute feststeht, daß die ersten Lösungsversuche, die den Menschen von den zur Zeit lebenden 5 Affenarten ableiten wollten, unhaltbar sind.
Für die Wahrheitsproblematik ist jedoch gerade der dritte Akt, die Verifikation, das heißt, daß das Ergebnis als „wahr“ erwiesen wird, wichtig. Dies Verfahren besteht darin, daß das Ergebnis mit allem, womit es in Beziehung steht, verglichen und festgestellt wird, ob es nicht in Widerspruch mit dem übrigen Wissen steht. Gerade der negative Beweis ist da methodisch oft erhellend. Daß man den Gorilla nicht als Vorfahren des Menschen ansieht, gründet sich auf die tiefgehenden Verschiedenheiten des wahrnehmbaren anatomischen Baus, [156] auf Schlüsse, die man aus dem seelischen Verhalten und vielem sonst zieht, vor allem auch darauf, daß nicht genügend Übergangsformen nachzuweisen sind und daß der Gorilla selbst keine Urform des Affen ist, sondern als sehr spezialisierte Sonderform erkannt ist, deren Entwicklung nicht auf den Menschen hin, sondern gerade von ihm weg führt.
Daß das Denken, nicht als angeborene Begriffsschematik, sondern als problemsetzendes und -bearbeitendes Denken der wichtigste Weg zu neuen Wahrheiten ist, wird weniger in der Erkenntnistheorie als in der Erkenntnispraxis anerkannt; denn fast alle großen Entdeckungen der Einzelwissenschaften sind auf diesem Wege erbracht worden. Und gerade der Welt als Ganzheit gegenüber ist heute klar, daß wir keine ausreichende Weltanschauung oder einen fest umrissenen Weltbegriff haben, wohl aber das Problem „Welt“ viel schärfer, weiter und tiefer erfaßt haben, als es in früheren Zeiten möglich war. Ich werde später zeigen, daß die uralten kosmischen Probleme Raum und Zeit, Substanz und Formung, Kausalität und Finalität zwar nicht restlos gelöst, aber als Probleme anerkannt sind, denen gegenüber die Erkenntnis des Noch-nicht-Erkannten, ja, vielleicht sogar des grundsätzlich Unerkennbaren selbst den Charakter einer „Wahrheit“ erhalten kann. Und gerade die „Problematik“ gehört zur „Wahrheit“ über die Welt, das Wissen um die Fragwürdigkeit von Lösungen, die man früher für Wahrheit gehalten hatte.
Das praktische Handeln und das pragmatische Wahrheitskriterium
Gegen alle bisher geltenden Erkenntnis- und Wahrheitstheorien ist um 1900 von Amerika aus eine Platzbombe geworfen worden, die von den rein intellektualistischen Theoretikern, die Erkenntnis und Wahrheit für eine Sache des Kopfes allein, für eine reine Bewußtseinsangelegenheit hielten, mit Empörung aufgenommen, beschimpft, aber nicht sachlich widerlegt wurde. Diese Platzbombe bestand in der Behauptung, die Wahrheit einer Lehre beruhe auf ihrer praktischen Bewährung, weshalb sich die neue Theorie auch „Pragmatismus“ nannte. Es kann zugegeben werden, daß insbesondere die Anwendung der Theorie gerade aufs religiöse Gebiet etwas grobschlächtig war, und daß sie den Anteil des Bewußtseins im Erkennen unterschätzte. Aber daß die Pragmatisten recht damit hatten, daß das Erkennen sehr wesentlich eine Sache der Hand und des Handelns ist, und daß es eine Stütze der Wahrheit ist, daß sie sich praktisch „bewährt“, das kann nicht abgeleugnet werden.
In der Ästhetik hat man darum gestritten, ob Raffael, ohne Hände geboren, ein großer Maler geworden wäre. Sicher ist, daß die Menschen, wenn sie lauter Kants ohne Hände gewesen wären, recht wenig Wahrheiten gefunden hätten. Weder die Physik, noch die Chemie zum Beispiel wären dann zustande gekommen, und wir haben bereits früher erwähnt, wie wichtig die Hand, als Mittel indirekter Erkenntnis, auch als Organ der Wahrheitsfindung ist. Ob Troja nur eine [157] Erfindung Homers gewesen ist, suchten die Philologen vergebens aus schriftlichen Überlieferung zu ermitteln. Als jedoch Schliemann zum Spaten griff und an der Stelle, wo man Troja vermutete, nicht die Ruinen einer Stadt, sondern mehrerer Städte übereinander fand zweifelte niemand mehr am realen Untergrund der alten Sagen. Und wir haben bereits gezeigt, daß das problemsetzende Denken zur Bearbeitung seiner Probleme sich nicht bloß des Denkens, sondern vor allem praktischer Akte: Experimente, Forschungsreisen, Apparate und vieler anderer Hilfsmittel bedient, die nicht allein durch Vorgänge in menschlichen Gehirnen, sondern durch die Praxis Wahrheiten erbringen.
So gewiß nun im Leben und auch in der Wissenschaft seit je die praktische Bewährung als Kriterium der Wahrheit gegolten hat und heute noch mit Recht gilt, der Pragmatismus ginge doch zu weit, wenn er darin das einzige, und zwar ein unfehlbares Kriterium sehen wollte, was die klügeren Pragmatisten auch nicht tun. Denn es läßt sich sehr die Wahrheit oder Irrigkeit eines Satzes auch ohne praktische Probe erkennen, und eine praktische Bewährung beweist nicht immer, daß diese eine Folge der sie herbeiführenden geistigen Akte war. Darüber ist schon oben gesprochen worden. Die Wissenschaft benutzt vielfach „Arbeitshypothesen“, d. h. Annahmen, mit denen sich arbeiten läßt, die aber trotzdem noch nicht als „Wahrheiten“ anerkannt werden. Nur wo die Kausalverhältnise einigermaßen übersehbar und in allgemeine Gesetze formulierbar sind, darf die praktische Bewährung als Wahrheitskriterium gelten: dann aber ist sie in sehr vielen Fällen von entscheidender Bedeutung. Der Pragmatismus hat die praktische Bewährung auch für Weltanschauungsfragen, insbesondere die Religion, herangezogen, die sein glänzendster Sprecher, William James, als eine „Haltung zum Universum“ definiert, besser würden wir vielleicht noch sagen: ein „Verhalten zur Welt“, denn es handelt sich in der Religion nicht um Theorie, zu deutsch Anschauung, sondern um eine Form des gesamten Lebens, das praktische Verhalten einbegriffen. Indessen darf man – und darin gehe ich nicht mit den Pragmatisten – das Wahrheitserleben religiöser Menschen nicht mit der Erkenntniswahrheit der Wissenschaft zusammenwerfen. Darüber wird erst am Schluß dieses Essays zu sprechen sein.
Exkurs über Mathematik
Die Unentbehrlichkeit des Sprechens und praktischer Tätigkeiten fürs Denken läßt sich vielleicht am schlagendsten darlegen gerade auf dem Gebiet, das seit dem Altertum als Leistung reinen Denkens gilt: der Mathematik. Sowohl die Grundbetätigung der Arithmetik, das Rechnen, wie die Grundbetätigung der Geometrie, das Messen, sind ursprünglich praktische Akte, nicht reine Denkleistungen, so geniale Abstraktionen man auch daraus gewonnen hat.
Der beste Beweis, daß bereits das Zählen, die Voraussetzung sowohl des Rechnens wie des Messens, nicht bloß im Kopfe, sondern unter Zuhilfenahme der Hand zustande kam, ist das Dezimalsystem; die [158] besondere Stellung der Zehn beruht darauf, daß primitive Menschen überhaupt nur mit Hilfe ihrer zehn Finger zählten und rechnen können. ...
===================
[179]
IV
DIE EINHEIT DER WELT
Einst träumte man von der Musik der Sphären
daß alle Sterne, die den Himmel zieren,
zu edlem Reigenchor vereinigt wären
nach eines großen Meisters Dirigieren.
Uns sind die Sterne leider ewig stumm,
und was wir aus der Welt an Klang vernehmen,
will sich fürs Ohr beim Erdenpublikum
nicht überall zur Harmonie bequemen.
Und dennoch hört man manchmal mit Erstaunen
auch vieles, was sich fügt zur Melodie;
und wirrer Stimmen widerstreitend Raunen
löst plötzlich sich in reiner Harmonie.
Vielleicht ist's, weil wir nie das Ganze hören,
vielleicht ist nur zu eng des Menschen Ohr,
daß nie die Stimmen, die einander stören,
vereint erklingen in erhabnem Chor.
=============================
RICHARD MÜLLER-FREIENFELS
Der Mensch und das Universum
Philosophische Antworten auf kosmische Fragen
Nymphenburger Verlagshandlung München
1. bis 10. Tausend: 1949
Copyright 1949 by Wegweiser-Verlag GmbH., Berlin
----- ENDE des Auszugs des Buches „Der Mensch und das Universum“ -----
----- von Richard Müller-Freienfels -----
Erstellt am 20.11.2010 - Letzte Änderung am 01.08.2012.